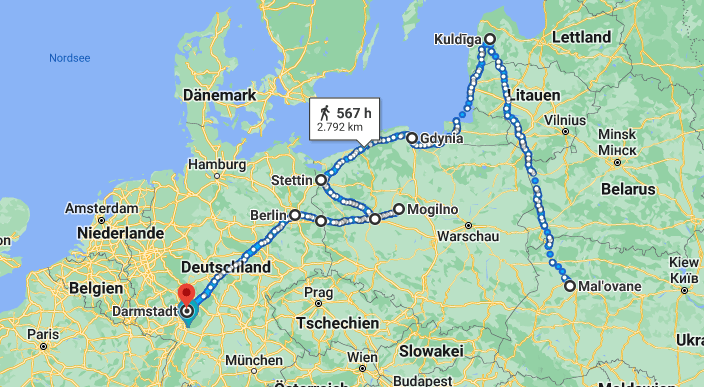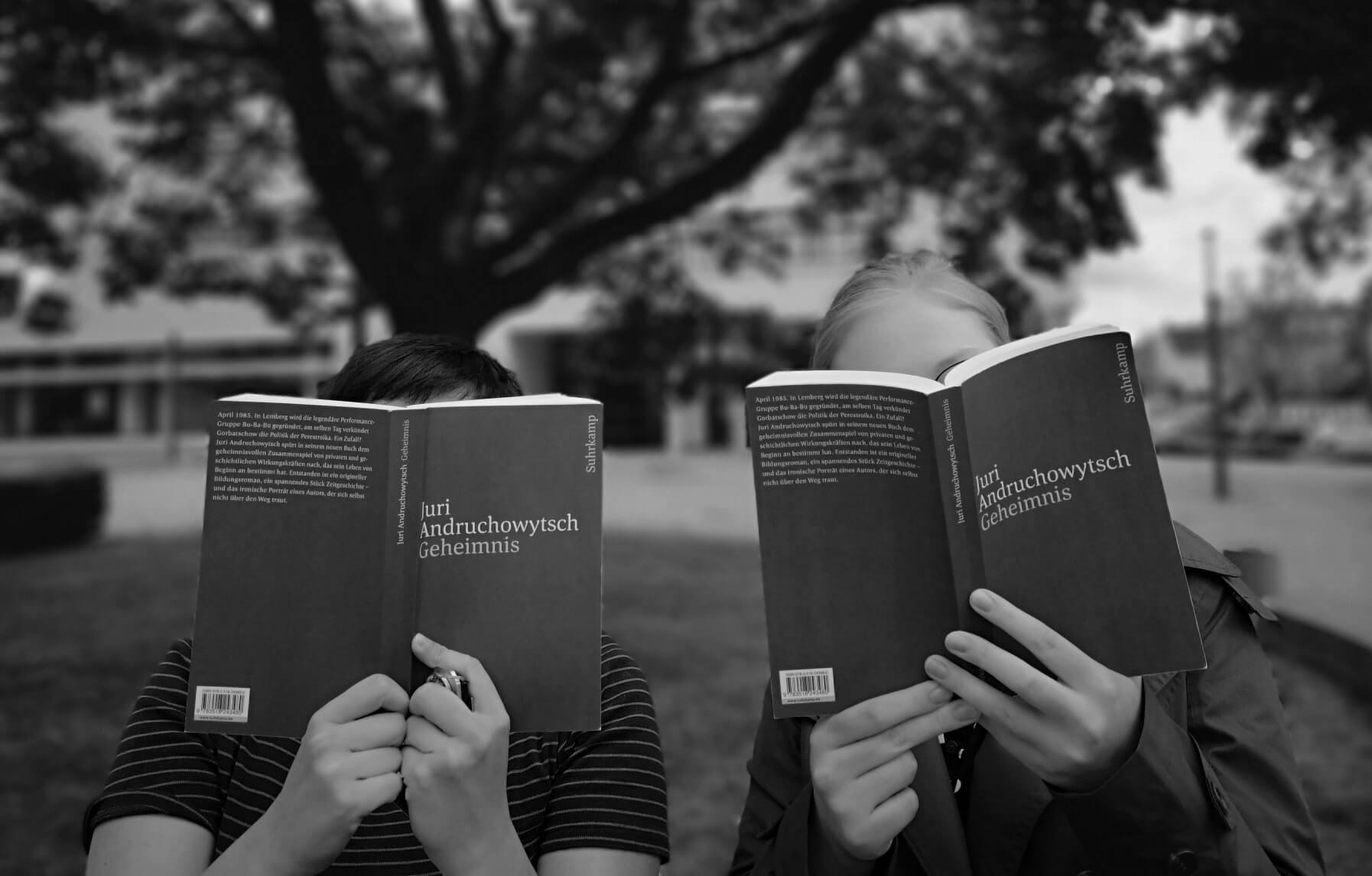Die Vorstellung, wir könnten etwas anreichern, nähren, etwas wie Erkenntnis, Einsicht, ästhetische Wahrnehmung, ein Werk, ein Ganzes: das sind Geschichten und sie sind geklaut. Also erzählt, gemacht aus anderen Geschichten, die Geschichten von solchen Umbrüchen sind. Also möchte ich zweifeln, auf eine Art, die nicht schwerfällt, die nicht abwehrt oder begehrt, sondern selbst eine Geschichte ist, die unendlich variiert wird: Es könnte auch anders sein. Aber nicht ganz anders, sondern nur als ob. Den Zweifel zweifeln, der sich von sich selbst versteht, der sich erledigt, als Signatur, die ich vergessen kann, verlege, verräume, damit mindestens ich sie nicht mehr finde.
Ein Werk, sagt sie, sei, auch wenn es geklaut sei, so wie alles geklaut sei, eine Architektur, die sie nicht bereit sei in die Luft zu sprengen. Auch geklaute Treppen, Wände, Kammern, Zwischenräume und Nischen seien eine Weile lang begehbar. Jedenfalls habe sie das bisher so gehandhabt. Sie sehe sich als Hausbesetzerin. Sie sei auch nicht bereit, dieses Bild so schnell aufzugeben. Ob ihr Hirn im Dachstübchen sitze oder im Fahrradkeller, das könne sie nicht sagen.
Jedenfalls habe sie die Schlüssel verloren. Das sei aber auch egal, denn die Türen seien längst zersplittert, jeder und jede könne hineinkommen. Dieses brüchige Werk lasse sie sich nicht nehmen. Wenn es dann in sich zusammenstürze, sei sie schon längst an einer anderen Stelle zugange und müsse dann auch nicht groß rumheulen. Immerhin habe ihr Haus eine Zeitlang eine Menge Gäste beherbergt, ständiges Kommen und Gehen, auch die ein oder andere fette Party.
Also nichts Festes und das Wort los lassen, den Satz. Ich werde gerinnen und auftanzend widerscheinen, wohnen in jedem brüchigen Deut, in dem zusammenstürzen, als das ich ergriffen werde und mich bringe und reize, mich ermattet davon mache, in gleicher Form und immer entgegengesetztem Sinn. Das ist mein Plan für nichts, das Modell der Verausgabung, diffus und roh.
Ich finde einen Entwurf wieder, den ersten, von weit her, von sehr weit, aus der größtmöglichen Reichweite der Wahrheit, in welcher Form oder Art oder in welchem Körper es auch sein mag, erkenne ich das traurige Glück, in dem jedes Merkmal der Wahrheit außer Sichtweite gerät und alles Geschriebene blendet. Ich sehe sofort alles und ich sehe nichts.
Auf sichtbare, lesbare Weise habe ich diesen Entwurf inszeniert, in dem unversehens erwischt, wovor ich immer auf der Hut war und so oft den Text umgeschrieben habe, in dem wir blind sind und kämpfen und uns selbst zerreißen, um gesehen zu werden, wie wir sehen und wie wir in Stücke gerissen werden. Ich behalte meine Splitter und Lücken in meinem Text und setze sie in Klammern. Darin nehme ich die Nähte auseinander und kämpfe mit mir selbst, zerreiße mich.
Das Geheimnis des Nature Writing: rausgehen, sich umgucken, Möglichkeiten und Zweifel vergessen, sich selbst ausklammern (als sei das möglich), die Augen aufreißen, als könne man etwas sehen und verstehen, nur weil es sich ins Blickfeld schiebt, sich Einfachheit verschreiben wie eine Kur, wieder an die Beschreibung glauben, wieder an das Verlorene glauben oder überhaupt glauben, Zerrissenheit den Amseln überlassen. Über Hagebutten schreiben. Etwas zu wissen glauben.
Ich probiere das und schreibe über Kiefernwälder, das Geräusch von Schilf, das Geräusch eines zerplatzenden dickschaligen Kartoffelbovists, die Farben der Moose, wie heißen die eigentlich, wie heißt das überhaupt alles hier, diese borkige Rinde an diesem Baum, der keine Birke ist, obwohl er so aussieht, was ist mit den Steinen, wer schreibt über die Steine, diese Schichtungen, wie soll ich von Steinen schreiben, für die niemand zuständig ist, schon wird es wieder kompliziert, speckled beauty (Gerald Manley Hopkins), es könnte auch anders sein.
Ich verstehe das nicht. Wir fangen mit dem Unbestimmten an, aber in einer Zeit. Das Eindeutige hat keine Bedeutung. Wir gehen doppelt verloren. Ich lese noch einmal und spreche nun von Mechanik und Flüssigkeiten, von Turbulenzen, von Beugungen, die jede Symmetrie brechen. Ich konnte das nicht lesen, solange ich dazu verpflichtet war, von etwas Festem auszugehen, das nur eine Zeit hat und nicht eine, die sich mischt und teilt mit anderen, in denen die Rinde geschält, der Bovist zerstreut und die Moose verzweigt sind.
Dafür braucht es keine Entschiedenheit, dafür braucht es sich akkumulierende Theorien, sich gegenseitig ausstreichende Theorien, die anhalten und brechen, sich beschleunigen und Risse verursachen, einen Schacht graben, sich aleatorisch verstreuen, Unordnung schaffen, mit denen ich auf keiner Linie mehr schreibe, sondern Strömungslehre und Nachbarschaft zusammenrücke.
Dafür krümme und falte ich mich. Was ich schreibe, verrinnt nicht, es versickert. Ich baue laminare Filter, die mich verstehen. Und ich schreibe einfach weiter. Die Geschichten enden nicht, denn sie haben keine Helden. Wir jagen und erlegen nichts, sondern lesen auf und sammeln ein, für weitere Geschichten, in ein Netz aus Haaren, ein zusammengerolltes Blatt, nehmen das mit nach Hause, was nichts ist als “ein anderer, größerer Beutel, eine größere Tasche …, ein Behältnis für Menschen” (Ursula K. Le Guin). Was ich schreibe, kommt da hinein und ersetzt, was schon enthalten war. Das war das, was ich schreiben wollte.
Ich kann nicht mehr über das Schreiben schreiben. Aber ich kann auch nicht über den Bovisten schreiben. Ich kann nicht über Ruinen schreibe und auch keine Ruinen schreiben, keine Anfänge und Enden, aber die Zwischenräume finde ich auch nicht. Ich setze Mittel ein, um darüber zu schreiben, dass ich es nicht tue. Ich wende alles gegen mich. Ich löse die Sprache vom Bovisten, es bleibt der pulvrige Staub, der in kleinen Wolken über dem feuchten Laub steht, durch das ich gehe. Ich nehme nichts mit nach Hause und nehme nichts persönlich.
Ich schreibe also, was ich schreibe. Ich muss die Abgründe offenlegen, die Hohlräume zum Klingen bringen, den Wahnsinn des Bedeutens. Ich muss, wenn ich schreibe, alles umkehren, von rechts nach links, von unten nach oben. Ich muss verwerfen, was gemeint war, daran reiben, bis es angegriffen wird, rostig und löchrig. Dann ist alles leicht zu erschüttern: was ich meine und das, was ich auch noch gemeint habe.
Was ich gemeint haben könnte und sollte, aber so nie gesagt oder geschrieben habe, aber als Wahrheit in diesem Verfall zu entdecken ist. Jede Bezeichnung eine Ruine, jede Stimme ein Nachgeschmack, unter den ich mich werfe, damit ich keine Stimme mehr bin oder habe. Jedenfalls keine, die Mittel einsetzt, die weiß, die etwas will, deren Ziele ihr schon eingeschrieben sind.
Es gibt diesen Satz von Maurice Blanchot, aus Warten Vergessen: Der Raum ist leer, das ist seine Haupteigenschaft. Und ich denke, wenn der Raum leer ist – es gibt keinen Grund daran zu zweifeln –, wenn das seine Haupteigenschaft ist, dann kann jedes Sprechen, das in ihm stattfindet, auch nur leer sein. Eine Leerstelle von geringerer Ordnung. Es ist nicht anders möglich. Sprache befüllt nichts, erfüllt nicht. Sie ist kein Zufluchtsort. Sie gewährt keinen Aufenthalt. Sie kann höchstens eine Leere vermessen, indem sie eine andere Leere ist.
Senthuran Varatharajah
Die Notwendigkeit liegt in dem Bruch zwischen den Worten, die ich kenne, die höre und lese, die ich gesammelt habe, die ich mir in Erinnerung rufe. Also wende ich, was ich schreibe, gegen das, was ich geschrieben habe. Damit wird die Gleichung von Leben und Tod aufgehoben. Damit schreibe ich das, was dazwischen liegt, was sich anheftet und was sich ablöst.
Wörter wie Schatten, Sätze wie Wind oder Spiegel. Immer wird etwas vergrößert und umgekehrt. Solange, wie wir vorausschauend oder im Rückblick nur noch von Formen sprechen können und von Formationen wie Werken. In deren Flächen sind die Risse integriert, aber im Lesen finden wir sie wieder.
(Das Buch ist) eine offene Zeitkapsel, in der die Spuren der seit seiner Niederschrift und seiner Drucklegung vergangenen Zeit mit verzeichnet sind und in der jede Ausgabe eines Textes sich als ein der Ruine nicht unverwandter, utopischer Raum erweist, in dem die Toten gesprächig sind, die Vergangenheit lebendig, die Schrift wahr und die Zeit aufgehoben ist.
Judith Schalansky
Ich komme zurück, ich komme darauf zurück, ich werde darauf zurückkommen, ich werde darauf zurückgekommen sein, was mir nicht mehr erreichbar ist. Ein Ort, an dem ich sein, aber nicht bleiben kann, wo ich aufgehoben bin. Ich hebe mich auf und entschwinde, ganz leicht, nicht mehr gültig, wenn da je was galt, ist es jetzt aufgehoben, dieses Sein, das nicht bleiben kann.
Der Ort, der sich so leicht aufheben lässt und davontragen, deplatzieren, ist nicht des Aufhebens wert, scheint es, doch kommt es weniger auf den Ort an als auf die, die sich aufheben lassen, die wir aufheben für einen anderen Ort, bloß nicht diesen. Ich bin ja nicht allein, nie allein, sondern in Verbindung, in der flüchtigen Berührung der Erinnerung.