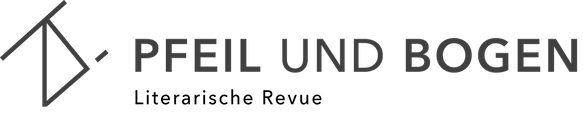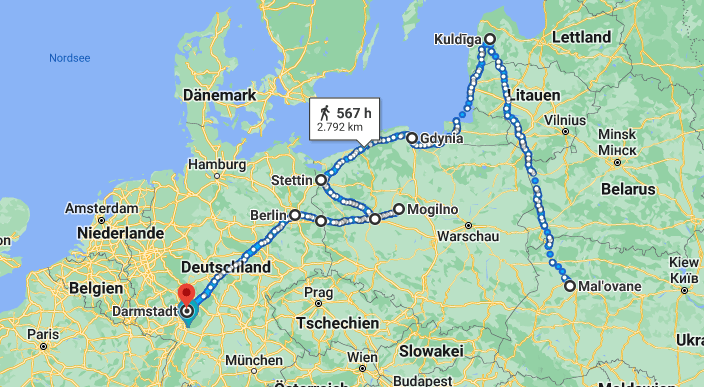Ich bin der Hase im Heidekraut, zurückgelassen vom alten Gruyere, gewalzt oder nicht, die Nase zum Mohn gedreht, glatter als eine Orange, jedes Laster erklommen, methodisch gegossen, die Laternen riechend, meinen Henker verfluchend, ein Riffel ohne Scheide, mit klebriger Sohle und stinkendem Zwilling im Morgengrauen, im Hemd zum Tanz in die Lampe, als krummes Kind aus Spargelspray wie jeder niedrige Gott.
Und ich: ich bin alles, was du nicht bist. Ich bin der große Erklärer in der Dunkelheit. Ich bin der, der Brosamen im Wald auslegt, weil ich an meine Logik glaube. Es gibt keine andere. Ich bin der Herr über Schneekanonen und Dauerwellen, der König der Excel-Tabelle. Mir kann man nichts, weil ich immer schon da bin, wohin Ihr auch kommt. Ich gewinne jede Wahl, weil ich die Wahlurnen an die richtigen Orte stelle.
Ich schlage zu, wenn das niemand versteht. Erklären muss man nicht mit Worten. Ich impfe meine Tochter mit einem Gift, das ich selbst niemals schlucken würde. Gewalt ist für mich nicht roh, sondern Politik. Mein Lachen ist golden. Alles ist erfunden außer mir selbst. Bevor Gott die Erde erschuf, erschuf er mich. Darum danke ich ihm täglich und lasse mich mit Bibeln fotografieren. Ich bin die Fratze, die ihr fürchtet und verehrt wie euch selbst. Ich bin Eier in Aspik. Nichts an mir ist krumm, alles gesund.
Wer das anders sieht, ist krank. Ihr nennt mich die Krankheit unserer Zeit, aber ich mache euch gesund. Denn ich bin auch der Herr der Ärzte, der Forscher und allen Wissens. Wer mir widerspricht, den lache ich aus, solange, bis nur noch Haut und Knochen übrig sind. Ich fresse alles, was sich regt. Denn mein Leib ist euer Leib, für euch gegeben. Nehmt, esst und trinkt mich. Träumt mich. Wählt mich. Und irgendwann werden wir eins sein.
Wir fürchteten uns vor Dieben und schliefen bei geschlossenen Fensterläden, rissen versehentlich einer Spinne ein Bein aus und schnitten in Mathematik ganz gut ab. Wir waren überaus begabt, Angst zu haben. Alles ist belebt. Wirklich erwachen wollten wir nie. Was könnten wir werden? Und was werde ich. Ich sorge mich um Schatten und lasse mich entmutigen.
Wir machen uns klein, damit aus dieser Perspektive alles unfassbar und schrecklich zugleich sein kann. Wir flicken und trinken. Wir müssen fliehen, doch wissen nicht wohin. Was soll ich anfangen auf dem Berg? Ambivalenzen pflegen, Launen plagen und verführen, Zweifel stören. Ich werde mich verwandeln und werde in einem Spiegel aufgefangen und festgehalten und dort allmählich zusammenschrumpfen.
Was zählt, ist das permanente Schreiben. So wird die wunde Seele im Zaum gehalten, mit Buchstaben und Geschichten balsamiert. Ich sei ein Doppelgänger, mein anderer Teil geht jetzt. “Könnte ich ein Land sein, / ich wäre Irgendland.” (Mirko Bonné) Ich wäre bedeckt, verhüllt, bewohnt. “Könnte ich irgendwann wohnen, / es wäre Herbst, Herbst, Herbst.”
Könnte ich ein Land sein,/ ich wäre Nixland.
(Mathew Sweeney)
Etwas anderes gäbe es nicht mehr. Der Rest kommt von ganz allein und dockt bei mir an. Der Zustand, wo ich nicht mehr schreiben muss, nicht mehr lesen. Was lebbar ist: Leben als Nachbeben grauer Sonnen und kahler Stunden. Das ist die Kurve.
Wir sitzen mit dem Rücken zum Fluss, auf der anderen Seite Wiesen und Felder. Was tue ich eigentlich. Ich erkläre nie etwas oder rechtfertige gar, erzähle nicht von meinen ungenauen Reisen. Ich antworte: ich warte. Das Warten ist die Sorge. Die Erinnerung ist der Nachvollzug des Verlierens. Erinnern heißt, verlieren zu lernen. Was wäre das Ende der Erinnerung? Was wir verlieren, gehört uns, als wäre es das einzige: Es gibt die Nicht-Welt und sie entsteht aus Verlieren. Das Sätze-Nichts, dessen Bestimmung seine Unbestimmtheit ist.
Eines aber bringt mich in die Welt, ganz unzweifelhaft. Wenn der Schmerz kommt, wenn der Körper kaputt geht, wenn du nur noch kriechen kannst und nicht mehr aufrecht gehen, wenn du aufwachst in brennenden Schmerz hinein und der Schlaf vielleicht nie wieder kommt, dann wirst Du zu einem winzigen, scharfen, dunkelglühenden Punkt. In diesem Punkt gibt es nichts mehr: Ankunft in Nixland.
Keine Fragen, keine Erinnerung, keine Sorge. Alles hat sich aufgelöst in der Glut. Nicht mehr schreiben, nicht mehr lesen. Nicht mehr gehen, nichts mehr wissen. Nur noch liegen und glühen. Von einer Sekunde in die nächste. Keine Angst mehr, denn in Nixland löst sich alles auf in der Glut der Gegenwart. Sekunden werden zu einem brennenden Strahl, an dem sich die Gegenwart entlang frisst. Was das mit mir zu tun hat oder mit dir, weiß niemand. Es ist ja auch niemand da. Aber auch dass ich allein bin, habe ich vergessen. Dass ich ein Außen und ein Innen hatte, ist vergessen.
Dass es mir besser gehen wird, ist vergessen. Auch dass es mir vielleicht nicht besser gehen wird. Es gibt keine Fragen mehr, das Denken ist verkocht. Wer sich an mich erinnert, kennt mich nicht, denn da gibt es ja nur noch einen Punkt. Mit Tabletten dehne ich ihn aus zu einer Kontur, die ungefähr den Erinnerungen der anderen entspricht. Ich schreibe diese Zeilen, solange ich mich halten kann. Ich kann aber die Kontur nicht lange füllen. Wenn sie verschwimmt, muss ich aufhören zu schreiben. Die Ränder kollabieren, ich ziehe mich in den Schmerz hinein, schrumpfe, verdichte mich zugleich, und nun ist es wieder Nacht, auch wenn sie taghell schimmert.
Der Schmerz, die Knochenflächen reiben aneinander, wird zum Fixpunkt. Er macht den unzuverlässigen Rücken gefügig. Er wird ein umgekehrtes Füllhorn. Fadendünn, aber unausweichlich die Ahnung, dass ich verantwortlich bin. Ich höre nicht hin. Und wenn, dann nur unwillentlich. Allzu leicht stellt sich etwas wie Geblendetsein, vom Schmerz, von seiner Anwesenheit. Das ist auch die Geschichte der Ichaufgliederung. Moi, die Suche nach Halt, je, der Schmerz, der den Körper in der Mitte bricht, zernichtet und zugleich festschnürt.
Er ist präsent, als Negativform, als Antrieb, der in den Falten dieser verwüsteten Tage kauert und beharrlich durch seine Anwesenheit und noch in ihrem bloßen Nachscheinen ausplaudern lässt, was niemand behaupten würde, verbergen zu können – und doch tut: sich selbst als der, der er sein soll. Die Schrift und ihre Verdornung, ob Zierat oder Hindernis, geben den Halt, der nötig ist, um ein Vanitas-umwölktes Pandämonium einer zur Gegenwart geronnenen Folge zu entwerfen.
Abstraktion zerrinnt im stetigen Strom der Wirkstoffe. So wie ich, anders als ich, liegen Tausende, Hunderttausende, auf dem Bauch, auf dem Rücken. In der Mitte durchgebrochen oder zusammengeschlagen, abgeschossen oder vom Virus kaltgestellt. Nichts ist vergleichbar, niemals, aber ich sehne mich nach einer community of pain, ein wehleidiger Wunsch, den ich mir heute nicht verbiete. Alles, was ich brauche, steht mir zur Verfügung, selbst im Schmerz auf Watte gebettet. Ich will mich bei einer community entschuldigen, die es nicht gibt. Putins Tochter ist jetzt geimpft. Auf dem Rücken kann ich schreiben, die Hände nach oben gestreckt wie ein winkendes Insekt.
Wie könnte das Romanschreiben eine hilfreiche Reaktion auf die Probleme sein, mit denen wir derzeit als Spezies konfrontiert sind? Worin unterscheidet es sich von den vielen anderen Dingen, die Menschen ‘erschaffen’ – Autos, Kraftwerke und Waren, die man kaufen und konsumieren kann – von allem, was Platz beansprucht und Ressourcen verbraucht zu dem alleinigen Zweck, die Bedürfnisse des Ich zu befriedigen und es im Gefühl seiner Bedeutsamkeit zu stützen? Und doch hatte auch ich mein kleines Fleckchen Erde auf genau diese Weise genutzt.
Rachel Cusk, “Annie Ernaux lesen”
„Wir dividieren die Summe der Tage durch die Summe der Nächte und erhalten eine fensterlose weiße Fläche.“ (Simon Werle, Der Schnee der Jahre) Dieses Weiß, es kann beschriftet werden, es trägt schon alle Zeichen in sich und nur ihr mühsamer Abrieb kann sie zu Tage fördern. Was bei der Division herauskommt, hält, und das ist die fensterlose Drohung. Eine Zeit, in der alles zu ersticken droht. Luft auf Luft. Das Wissen als Distanzgebot. In der Fassungslosigkeit schlummert das Wiedererkennen, von seiner Form befreit. Abgrund Elevation sind gleich. Wir ziehen einen Saum, ohne dass das Gewebe dort endet. Es gibt nur Außenwände.
Wenn Künstler zusammen „arbeiten“, so kann das verschiedene Gründe haben. Der würdigste Grund wäre es wohl, wenn in ihr eine „Wahrheit“ zu Tage träte, die außerhalb unmöglich zu Tage treten kann. Üblicherweise malt man Bilder allein – ebenso wie man allein stirbt. Die „Vergesellschaftung“ der Bildproduktion ist ebenso unmöglich wie die „Vergesellschaftung“ des Todes. Wie aber, wenn sich im „Ereignis“ der Zusammenarbeit dreier Maler eine Wahrheit eigener Art enthüllte? Wir versuchen, einen neuen Weg zwischen Werk und Leben, Poiesis und Praxis, Bild und Ereignis, Sehen und Hören zu bahnen, einen Weg, der zugleich ins Herz des Dilemmas unserer Epoche führt – so hoffen wir.
Institut für Untersuchungen von Grenzzuständen ästhetischer Systeme (INFuG), documenta 8
Stirb ein langes Leben, so lautet das Schibboleth der Community of Pain. Das Kleine, das Wenige, das wir werden müssen, in dem wir die Jahre verbrennen und an den Freunden sterben, die wir nicht haben. Daran reibe ich mir die Ferse wund, fühllos unter Glas, die Sehnsucht geprellt, gequetscht der innere Leib. Die Haut dann schmeckt bitter. Subkutan unvollendet. Ein katholisches Selbstverweigerungsgeschwür, dem Lust allein in der Deformation allen Fleisches geläufig ist, das sein Wissen und seine mörderische Wut allein gegen sich richtet, gefasst im Korsett ewig rechthaberischer Duldsamkeit. Nichts bleibt spurenlos. Meine rücksichtslose Schwäche. Ungesellig und selbstgenügsam sind die Unvollendeten, die Angstredner und Ichinsassen.
Ein Trichter, wir gehen spazieren, die Schüssel, der Spaten sind dabei, auch hinlänglich bedacht, wie das Emaille und wie werden wir jetzt wach, mit dem Leder auf der Stirn der Flüsterrabe in Öl, flüsternd im Tunnel, wie nur wir, wir gehen spazieren.