Rede zur Eröffnung der Spielzeit “Fluss” 2019/2020 im Literaturhaus St. Jakobi Hildesheim
Der reißende Strom wird gewalttätig genannt. Aber das Flußbett, das ihn einengt, nennt keiner gewalttätig.
Bertolt Brecht
Der Fluss überschwemmt, verschlingt. Landunter lautet der Schrei.
Ein Flut bricht über uns herein. Die Bolschewisten, die Polen, die Russen, die Juden, die Vertriebenen, die Umsiedler, die Flüchtlinge. Dagegen müssen Dämme gebaut werden. Gegen die alles vernichtende Flut, die überall eindringt, vor deren Rauschen wir nichts anderes mehr wahrnehmen.
Was wir nicht verstehen, beschreiben wir als Naturvorgänge. Ist das eine Lüge? Ist das dumm? Wollen wir unsere Dummheit verschleiern?
Von den Strömen und Fluten geht nicht nur Bedrohung aus, sondern auch Attraktion.
Der Fluss tritt über die Ufer und der Hochwassertourismus setzt ein. Fernsehen und Internet zeigen Überflutungen von überall auf der Welt. Wahlen werden gewonnen von Politikern, die sich Gummistiefel anziehen und gegen die Flut stemmen.
Warum aber das Wasser? Warum nicht Eis oder Sturm oder Dürre?
Der Fluss, das Strömen, die Flut bieten nicht per se Metaphorik, die bedrohlich ist. Es geht um ihren spezifischen Gebrauch, den wir vor uns selbst verschleiern.
Vieles fließt in der Sprache. All die Brunnengedichte, die Sintflut des Alten Testaments und im degenerierten Sprichwort, das stille Wasser, das unschuldig, aber auch verheißungsvoll oder unheimlich sein kann. Die Flut an Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt, an Audrucken und Kopien, die für den Unterricht verteilt werden. Politische, literarische, geistige Strömungen: Von welchen Köpfen fließt da was in welche Köpfe? Die Metapher verheißt uns die alte Wunschvorstellung einer vorsprachlichen Verknüpfung unserer Gedanken und Ideen, davon, Einfluss nehmen zu können, ganz invasiv: wir dringen ein in ein anderes Hirn. Deshalb brauchen wir auch Datenströme. Denn wir wollen nicht rechnen und schalten. Wir wollen keine Widerstände und Dämme. Es sei denn, der Pegel wird überschritten und unsere mehr oder minder geheimen Wünsche werden erfüllt. Dann kippt die Idee von der Freiheit des Fließens und wir beginnen umgehend Sandsäcke zu füllen. Wer das nicht tut, lässt sich treiben und zählt schnell zum Abschaum. Wir wollen festen Boden unter den Füßen haben, im Regelfall.
Wenn wir uns selbst bewegen, dann geht das anders als fließend. Wir brauchen eine Form, eine feste Einheit. Alles, was fließt, deutet darauf hin, dass etwas undicht ist. Wir können es nicht greifen und werden von Ekel ergriffen.
Dieses Wir – Klaus Theweleit hat das bereits 1977 eindrucksvoll in seinem Buch Männerphantasien ausführlich gezeigt – sind nicht wir alle. Das Wir, das so spricht und unwillentlich, unbewusst und voller Widerstand und Hass sich vor Fluten ekelt, ist vor allem ein männliches Wir. Eines, das auch Schwierigkeiten hat, Ich zu sagen.
Um dem zu begegnen, diesem Wir und seiner Gewalt entgegentreten, es aber auch verstehen zu können, frage ich hier nur nach dem, was zwischen den Zeilen steht. Nach der langen Tradition, die mit der menschlichen Vorstellung des Fließens einhergeht. Nach einer Geschichte der imaginären Ströme. Nach einer Metaphorik, die Körperflüsse und Ströme der äußeren Natur gleichsetzt, Nervenströme und elektrischen Strom analogisiert, das Kleinhirn zu einer Art Batterie macht, mit Säftetheorien zu erklären versucht, wie die Temperamente der Menschen miteinander in Kontakt treten, wie sich die Psychoanalyse die Kräfteverhältnisse der seelischen Instanzen erklärt – bei aller Skepsis, die Freud gegenüber dem äußert, was er das ozeanische Gefühl nennt: das Unbegrenzte, Schrankenlose, Allmächtige. Allein der Verliebtheit gesteht er die metaphorische Macht zu, die Grenze zwischen Ich und Objekt verschwimmen lassen zu können.
Aber auch bei Freud, der ein begnadeter Stilist war, wirkt der metaphorische Komplex des Fließens über seine Kontrolle hinaus. Immer wieder verwendet er in seinen Schriften – ob für den Aufbau der Traumdeutung oder die Arbeit der Psyche – das Bild des Emporsteigens, Auftauchens, des Ziels, endlich nach oben gelangen zu können. Da ist die Luft zum Atmen.
Die Angst vor einer möglichen Grenzenlosigkeit, in der alles zerfließt und das überflutet wird, woran sich das arme Ich klammert, kann Aggression und Gewalt auslösen. Sie wird aber auch als Glück des Bei-sich-seins verklärt. So oder so: Die Vorstellung, dass dieses ozeanische Gefühl auch zugelassen werden könnte, hat keinen Raum. Wilhelm Reich hat das 1927 in seiner Schrift über die Funktion des Orgasmus kritisiert. Reichs Provokation bestand darin, dass er bereit war, das Strömen der Lust als Realität anzunehmen, demgegenüber eine metaphorische Absicherung aus Strömen und Flüssen ein Modell baut, in dem die Lust nur als Trieb im Keller Platz findet, während Es, Ich und Über-Ich in den Stockwerken darüber herrschen. An die Stelle der Bewegung tritt ein System, das unsere Wunschproduktion nicht mehr kennt, sondern verwaltet. Anders – verkürzt – gesagt: die Angst längst offen Rechtsradikalen, die sich selbst tatsächlich noch bürgerlich nennen und uns damit okkupieren wollen, vor z.B. den Flüchtlingsströmen, ist die Angst vor dem eigenen Unbewussten. Davor, damit in Berührung zu kommen. Alles Fließende und Strömende muss still- und trockengelegt werden. Dass es hier, mindestens hinter der Kulisse des Offensichtlichen, auch um einen Kampf gegen die weibliche Sexualität geht, muss dann auch nicht mehr überraschen.
Man kann sich trainieren gegen diese Ängste und Zumutungen. Wir könnten uns Ishmael nennen und mit Herman Melville immer hinausfahren. Trainieren gegen den Haß gegen das Leben, gegen alles, was frei ist, läuft und fließt. Wir könnten uns an Goethes Emphase für die Lebensfluten halten. Die Literatur besingt das Fließen der Libido, feiert das Sich-treiben-lassen. Solange kein zwanghaftes Ziel vor Augen steht, ist das Glück gewiss. Das ist der Wunsch nach einem Leben ohne Mangel, ein verschwenderisches Schreiben, ein Überfluss an Ideen und Worten. Das ist die Realität des Gefühls, wenn man eben nicht den Mangel des Strömens der Lust am eigenen Leib erfährt.
Elias Canetti setzt der Welt des Totalitären, der Unterdrückung, des Hasses, der Ausgrenzung und Diskriminierung die Erinnerung an eine Welt entgegen, „in der der Verwandlung eine allgemeine Gabe der Geschöpfe war und unaufhörlich stattfand. Die Fluidität der damaligen Welt ist oft hervorgehoben worden. Man konnte sich selbst in alles mögliche verwandeln; aber man hatte auch die Macht, andere zu verwandeln. Aus diesem allgemeinen Flusse heben sich einzelne Figuren ab, die nichts anderes als die Fixierung bestimmter Verwandlungen sind. (…) Der Vorgang der Verwandlung wird so zur ältesten Figur.“
In dieser Verwandlung ist man Fremdem ausgeliefert. Warum muss daraus diese Härte gegenüber dem Fremden entstehen? Vielleicht geht es im Fluss auch nicht so sehr um die Verwandlung, von einem Zustand in einen anderen, sondern vielmehr um das Fließen, um das Vorübergehende, das Vorläufige, das Instabile. Wovor sollen wir uns schützen müssen? Vor dem, was das von außen kommt? Oder vor dem eigenen Inneren? Allein diese Aufspaltung zwischen Innen und Außen ist eine Erfindung der Moderne, die nach Verwandlung verlangt. Dr. Jekyll steigt in sein Inneres zu seinem Mr. Hyde und findet dort den bösen Mr. Hyde. Das Innere, wenn es gegen alle Tabu angerührt wird, ist immer böse. Es könnte da in uns etwas in Bewegung kommen.
Die Ströme dürfen für den ängstlichen und gewalttätigen Mann nicht fließen. Er ist darauf aus, sie am Fließen zu hindern: die ›imaginären‹ wie die realen Ströme, Spermenströme und Wunschströme, nicht einmal die Lust am Strom des Bösen, wie er in Mr. Hyde fließt, ist ihnen möglich. Diese Flüsse sind Boten einer drohenden Niederlage: ›wir gehen unter!‹.
Wenn auf der einen Seite von Flüchtlingsströmen die Rede ist und auf der anderen Seite etwa von einem Rede- oder Lesefluss, wird da zwar das gleiche Bildreservoir verwendet. Doch diejenigen, die das nutzen, haben ebensowenig etwas miteinander zu tun wie die zugrunde liegenden Motive. Ängste und Drohungen auf der einen Seite, Wohlgefühl und Emphase auf der anderen. Wer sich dem Lesefluss, dem Strom der Worte hingibt, versunken in seine oder ihre Lektüre ist, wird keine Angst haben vor Geflüchteten, die Grenzen überfluten und alles, was wir sind und haben, wegreißen wollen. Denn die Freiheit, die solch eine Lektüre verspricht, macht immun gegen solches Gift.
Aus solchen Flüssen kommt vielmehr Hingabe, Liebe sogar, Leselust ganz bestimmt. Denjenigen, die lieber Dämme bauen, ist solche und Lust überhaupt fremd. Was durch die Literatur fließt, ist ein Fluß ohne Ende, ohne Ufer. Hans Henny Jahnn hat einen Riesenroman darüber geschrieben.
Unproblematisch – und das wäre nun noch ein ganz eigenes Thema – sind natürlich auch diese Emphaseströme nicht, ihre Überhöhung, die das Fließen zu einem Prinzip der Entgrenzung und Entwirklichung machen, der unbestimmten unendlichen Lockung, die immer weiblich sein soll und Frauen dann eben so unterdrückt, ihre Körper negiert durch Anbetung.
Wichtig scheint mir hier zunächst nur mal der Hinweis, dass wir in unserem Sprachgebrauch ein wenig mehr metaphorische Reflexion walten lassen könnten, um Überhöhungen wie vor allem irrationale Ängste sichtbar zu machen, die Prozesse der Wunschproduktion, der gesellschaftlichen Verwandlungen und Bewegungen, die manchmal nicht mehr nur rhetorische Gewalt der Sprache. Was hilft dagegen? Am Ende seines dreibändigen Romans Fluss ohne Ufer kommt Hans Henny Jahnn auf die Dummheit zu sprechen und darauf, dass ihm das „einzig wirksame Mittel gegen die Dummheit“ das Mitleid zu sein scheint. „Das Mitleid fordert eine Voraussetzung: die Kenntnis, die Anerkennung fremden Schmerzes.“ Demgegenüber stehen die Gewalt und die grenzenlose Gleichgültigkeit. Jahnn machte sich allerdings keine großen Illusionen. Auf dem Fluss ohne Ufer findet eine düstere Reise statt, das Schiff der Reisenden sinkt. „Es ist wie es ist und es ist fürchterlich.“ Doch unsere Lektüre, die diesem Strom folgt, lernt das Gebot, das eine menschenwürdige Gesellschaft ermöglicht: Mitleid, Grausamkeit vermeiden, den fremden Schmerz anerkennen.



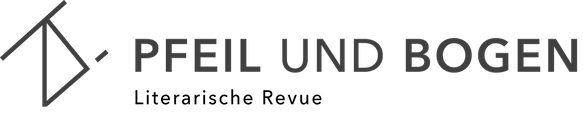










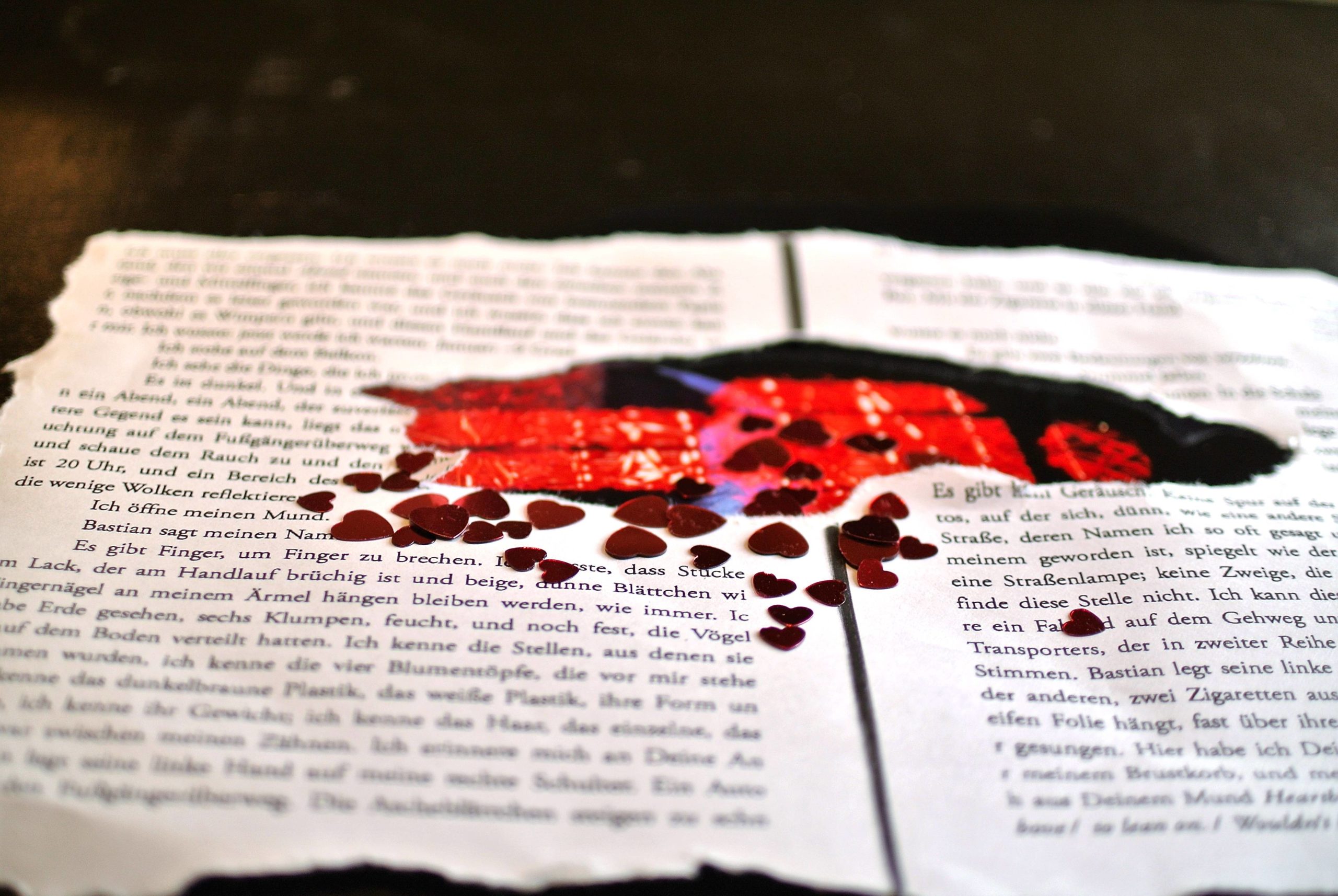
1 Kommentar
Das Flussbett muss der maximale Frieden sein, der alle Aktivitäten und Gesetze in sich vereinigt.