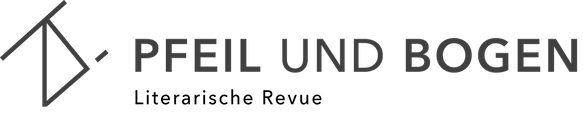Über eine nicht enden wollende Debatte
Seit die Autorin Margarete Stokowski Anfang November eine Lesung in der Münchner Buchhandlung Lehmkuhl abgesagt hat – Grund dafür waren Werke rechtsextremer Verlage im Sortiment –, überschlagen sich Kommentare, die ihre Entscheidung anfechten oder verteidigen. Stokowski wird als Vertreterin einer moralistischen, links-liberalen Echokammer geschmäht, genau wie als antifaschistische Publizistin mit Haltung gefeiert. Dazwischen gibt es wenig. Was eigentlich genau passiert ist, scheint die meisten zwar nicht zu interessieren, lässt sich aber in der offiziellen Stellungnahme der Autorin nachlesen: Es war Michael Lemling, der Inhaber der Buchhandlung, der den Vorgang im Nachhinein und entgegen anderer Absprachen skandalisierte. So ziemlich alle größeren Medien griffen den Fall dankbar auf, sponnen ihnen über mehrere Tage weiter und schrieben Stokowski wahlweise zur Kronzeugin oder Hauptangeklagten einer neuen Runde der Debatte hoch, die dem demokratisch eingestellten Teil der deutschen Bevölkerung seit dem Auftauchen von AfD und „PEGIDA“ immer stärker zur Distinktion nach innen dient. Vordergründig geht es allen um die Zukunft der Demokratie. Der Subtext aber stellt die Gesinnungsfrage: Wer ist demokratischer von uns?
Ende des Monats dann veröffentlichte der Sprachforscher Eric Wallis einen Text, in dem er sich auf die Seite all jener zu stellen schien, die Auseinandersetzung statt Abgrenzung fordern. Zumindest könnte er so verstanden werden: Sein Vortrag an der Universität Greifswald war von einer Gruppe „Identitärer“ gestört, oder besser: kurz unterbrochen worden. Die versuchte Provokation verpuffte schnell, ein Twitter-Video des ziemlich trostlosen Vorfalls wurde tausendfach angesehen. Es zeigt, wie leicht die plumpe Opfer-Inszenierung von Rechten auseinanderfällt, wenn sich die eine Seite nicht darauf einlässt: Wallis bietet den krakeelenden Jungs das Mikrofon an, fordert sie zur Diskussion auf. Sie aber packen ihr Transparent ein und trollen sich, veröffentlichen im Nachhinein offensichtlich gestellte Bilder, in denen sie von angeblichen Ordnern der Universität aus dem Saal gezerrt werden. Der Spott folgt prompt: Ein Punktsieg für die Ruhiggebliebenen. Nun sind aber auch gerade die „Identitären“ dafür bekannt, sich bei jeder Gelegenheit größer zu machen, als sie es sind. Wallis‘ Umgang war daher in diesem Fall goldrichtig und effektiv. In einem Interview zum Vorfall sagte er dann aber einen Satz, der stutzig macht: „Mit den Rechten reden ist unsere einzige Möglichkeit.“ Da war sie wieder, die griffige Allerweltsformel, aus einem Einzelfall gewonnen. Dabei hatte Wallis gar nicht mit der Gruppe geredet, sondern sie mit einem einfachen Kniff auf Normalmaß geschrumpft. Hätte die Gruppe dagegen nicht aus 15 Möchtegernrevoluzzern bestanden, sondern einen versierten Ideologen in ihren Reihen gehabt, hätten die Sache (und Eric Wallis) ganz anders aussehen können. Ob es davon ein Video gegeben hätte?
Das Problem ist: Beide haben sie recht, Stokowski und Wallis. Nur beziehen sie sich eben auf zwei komplett verschiedene Fälle. Und auch einem Dritten muss zumindest teilweise zugestimmt werden: Buchhändler Michael Lemling sagte, man müsse die Argumente des Gegners kennen, um sich mit ihm auseinanderzusetzen: „Wer sich gegen Rechts engagiert, sollte wissen, was Rechte denken.“ Da ist etwas dran, aber erstens: Wieso muss ich, um das Denken meines Gegners zu studieren, seine Bücher dafür auch noch offensiv verkaufen und ins Regal stellen? Zweitens, ist es ja nicht so, dass das rechte Weltbild ein komplexes Geheimnis wäre: Es ist überall zu lesen und hören, springt einem aus Bundestagsreden, Talkshows und Kommentarspalten zu jeder Tageszeit entgegen. Mit ein paar Klicks kann ich mich in Online-Parallelwelten begeben, in denen es sich vermutlich tagelang zwischen Verschwörungstheorien und Bürgerkriegsfantasien aufhalten lässt. Und drittens: Wieso wird eine Absage an den Verkauf einschlägiger Bücher mit der Verweigerung einer Debatte gleichgesetzt, als hätte es am Lesungsabend nicht um Stokowskis neues Buch, sondern den „großen Austausch“ oder den „Präventivkrieg Barbarossa“ gehen sollen? Als hätten „die Rechten“ als gleichberechtigte Gesprächspartner anwesend sein sollen und eine geladene Autorin sich der dringend gebotenen Diskussion über vollkommen legitimen Geschichtsrevisionismus verweigert.