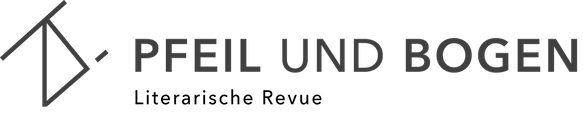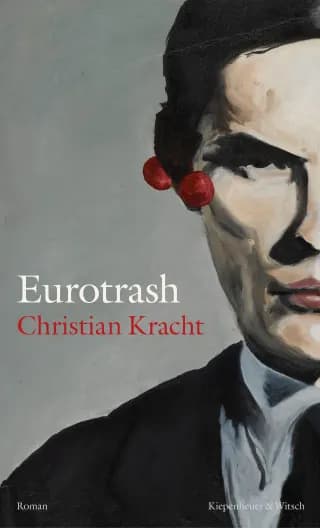Also, es ist Oktober und ich sitze endlich in der Küche meines PhD-Bruders, wo diese Erzählung beginnt, und denke daran, mit der Kritik zu Eurotrash anzufangen, den Test mit den zwei roten Strichen halte ich dabei in der einen, das Buch mit dem grandiosen Klappentext in der anderen Hand. Ich hatte mich Ende der Sommerferien, bevor ich mich endgültig auf dem Weg nach Hildesheim gemacht hatte, spontan dazu entschieden, meinen Bruder zu besuchen.
Zudem hatte ich, um mich für Eurotrash gut vorzubereiten, vor wenigen Monaten dieses Faserland nochmal gelesen, und war davon so fasziniert gewesen, dass ich während meiner Sommerferien zum lebendigen, jedoch misslungenen Pastiche der Faserland-Person Christian Kracht geworden war. Das hatte etwas von Don Quixote — wahrscheinlich ein schauspielerischer Effekt oder eine Nebenwirkung des versunkenen Lesens. Nun hatte ich jedenfalls diesen einen Satz gelesen — und meine Maske war gefallen.
Also, nun sitze ich endlich da, in Berlin-Mitte, der Bruder im Museum, der positive Corona-Test vor mir, was ja eigentlich deprimierend sein sollte, und meine Stimme fühlt sich an, als wäre sie voller Ekstase in dieser leeren, halligen PhD-Küche, nicht nur, weil ich endlich Eurotrash fertiggelesen habe und das Buch zugeklappt habe, sondern auch, weil ich das gelesen habe, was meiner Meinung nach der beste Klappentext ist, den ich je gelesen habe oder je gelesen haben werde, und zwar: ganz oben ist da ein Romanauszug zu sehen, die Anfangssätze des Romans, darunter, Kehlmann, als erste zum Nachnamen gewordene Stimmenautorität, sein Kommentar (ein viel zu langer Text), und als allerletztes, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, darunter Er, der großartige Handke, dieser, der ja im Grunde die Literatur ist und Homer und Cervantes. Und zwar, hier nun zu diesem Satz, dieser Urliterat, dieser salomonische Handschreiber Handke, der urteilt dort über den Kracht, mit der ganzen Kraft seiner blättrigen und blätter-streichelnden Hand einzig und allein mit dem Satz: „Christian Kracht ist ein ganz schlauer Bursche“.
Darunter hinterlässt er, par pistolet, seinen Namen.
In Großbuchstaben: PETER HANDKE.
Ich saß in der Küche und überlegte wohin mit meiner Euphorie.
Da war er also, dieser Satz, der mir gefehlt hatte. Meine Maske war gefallen.
In dem Moment, in der Küche, Corona-krank, ließ ich das Ganze unbewusste Kracht-Getue, dieses Epigonentum, welches ich in den letzten Monaten, als ich Faserland zum erneuten Mal gelesen hatte, an die Hand gelegt hatte, sofort fallen. In der Schlauheit, da liegt der wesentliche Unterschied. Meine Imitation, diese Imitation, die ich bald sehr detailreich beschreiben werde, war lächerlich gewesen, leuchtete es mir ein, sie war unlustig, sie war stumpf. Und was diesen Satz von Handke anbelangte: in Wahrheit sollte man, wenn man das könnte, nichtsmehr dazu sagen, dachte ich, als ich das las. Man könnte allein diesen Satz als Kritik stehen lassen. Man braucht nichts mehr hinzuzufügen, rappelte es in meinem Körper. Wozu denn noch mehr Sätze? Wozu die vielen Worte?
Da kann nämlich der Kehlmann so viel über Deutschland und über Gespenster und über Krieg und über Wahn schreiben, wie er will, nur, lässt er die Schlauheit aus, so lässt er auch den Faserland- und den Eurotrash-Kracht aus. Und letztendlich, Kehlmann: das einzig Wahre, wirklich Wahre, das heißt, das einzig wahrhaft Standhafte ist die Schlauheit Kracht’s. Das tut mir sehr Leid — dass er ein schlauer Bursche ist, ist Fait accompli. Und dass er das alles ganz ist, ganz Schlau, ganz Bursche und ganz Kracht, genauso. Vielleicht auch schelmisch, oder spitzbübisch, allerdings: eine saubere Schlauheit ist das. Kracht ist ein eleganter Frechdachs.
Nun, vielleicht sollte diese Kritik also eine Ode an Kracht’s Formen der Schlauheit werden, klopfte es mir an der Stirn, und ich überlegte, wie ich weiter vorfahren sollte. Genau da fiel mir ein, dass ich einfach versuchen könnte, so wie Kracht zu schreiben, und diesen Text als Ausgangspunkt nutzen könnte, um all das zu highlighten, was Kracht macht, das ich nicht mache, und was ihn zum schlauen Burschen macht, und mich nicht. Gar keine so schlechte Idee, meditierte ich — so könnte ich zudem auch etwas schreiben, was sich von der Kritik entfernt, etwas, das ich mir aneignen könnte. Also, wie gesagt, da saß ich nun, Delta ein- und ausatmend, und dachte darüber nach, wie tiefsinnig ein Handke ist, fragte mich, worin genau diese von ihm erkannte Schlauheit, der ich total zustimmte, bestand, und entschied, dass ich dieser Frage eine Erzählung meiner Ferien schreibend nachgehen würde. Das würde natürlich nicht gehen, wenn ich alles, alles imitierte, sagen wir mal konstante Erwähnungen von Kleidung oder Taxifahrten. Worin lag die Schlauheit Faserlands? Worin war ebendiese zur Schlauheit Eurotrash’s zu unterscheiden? Und worin unterschied sie sich mit meinem Manierismus, mit meiner unlustigen, ungewollten, na ja, Persiflage, die ich nun, anhand meiner Reise, exponieren werde? Worin, Peter, sag du es mir!
Lasst mich meine exemplarische Reise kurz oder lang erzählen.
***
Also, ich fuhr auf ein paar Wochen nach Bayern. Es war Anfang August und es hatte sich sofort ein Blablacar ergeben. Wir glitten im Gewitter über die Autobahn, ohne Tempolimit, in einem schicken Mercedes glaube ich, und ich hörte, wie der Fahrer, der eigentlich bis nach Südtirol fuhr, sich versprach und sagte „ich könnte dich ja dort umbringen“ (übrigens mit der Betonung auf das ‚dort‘), anstatt zu sagen, „ich könnte dich ja dort hinbringen“, woraufhin wir beide sehr laut, vielleicht zu laut, lachten.
Das war sozusagen der Beginn dieser Reise.
Um das nochmal genauer zu erläutern, ich hatte mich auf den Weg nach Bayern gemacht, um mit meinem Onkel eine sogenannte Wirtschaftsreise zu unternehmen. So nennt er die Reisen in denen er von Wirtschaft zu Wirtschaft fährt, um die unterschiedlichsten Fleischspeisen und Weinsorten auszukosten, meist irgendwo in der Nähe des Chiemsees. Ich sollte aber, nach einigen Überlegungen, nicht lange bei ihm bleiben, flog also bereits nach wenigen Tagen von Bayern nach Spanien, da ich allgemein, und das passiert mir immer wieder während dieser Wirtschaftsreisen, den Alpenföhn und die kleinen Salatblättchen, die zum Schnitzel serviert werden, und die schrecklichen Heißluftballons im Himmel nicht gut ertragen kann.
Ich landete also kurz darauf wenig begeistert im vierzig Grad heißen Madrid.
Ich hatte vergessen oder verdrängt, wie schwer es ist in Madrid zu atmen. Madrid ist eine schöne Touristenstadt. Für mich bleibt sie aber immer diese überpolarisierte Stadt der wie Trauerweiden-Blätter hängenden Balkon-Nationalismen. Nun war es bereits Mitte August, ich hatte mich bei meinen Eltern wieder eingelebt und ich spazierte durch meine schweißdrüsige Heimatstadt, da setzte bei mir diese Summer-Sadness ein, die mich während den Ferien nicht mehr verlassen würde. Ich weiß nicht mehr recht, wieso, aber als allererstes an diesem Tag sah ich mir die größte Spanien-Flagge Spaniens an. Ganze 294 Quadratmeter groß und ganze 35kg schwer flattert sie über die Plaza de Colón. Sie wird gehalten von einem 20 Tonnen schweren Mast. Dieser, wie ich meine, muss eigentlich das ganze Gewicht des aufkochenden Anti-Separatismus, der im Grunde ein Madrid-Separatismus ist, auf sich tragen.
Ach, und diese Fahne wird übrigens in einem Artikel der El Mundo sehr schlicht faschistoid, wenn nicht schon faschistisch, beschrieben als: ‚der größte Stolz Spaniens‘.
Stichwort‚ wenig begeistert‘.
Dort wiederum, auf den Platz stehend, dachte ich mir, ich sollte sobald wie möglich verreisen, irgendwohin, bevor ich in dieser Vergangenheit, die ja irgendwie noch da war, völlig einrostete. Sobald ich nach diesem Spaziergang die Türen zur Elternwohnung betrete, sagte ich mir, sollte ich meine Koffer packen und verreisen. Schnell in den Norden, dachte ich. Vielleicht, wie ich überlegte, zur Entspannung nach Asturien. Ja, nach Asturien. Wieso nicht mit dem Mitsubishi ein paar Tage ans Meer? Dem ganzen Madrider Firlefanz am Meer einen Strich in die Rechnung ziehen? Dieser Erzählung ein ähnliches Ende setzen, wie ein Kracht im Zürcher See, auf einem Schiff umgeben von Wasser, nur halt im Meer? Ja. Ich sah also diese Fahne und dachte, aus der Ferne (eigentlich stand ich ja inmitten eines Kreisverkehrs), an die Wellen, an das Rauschen, an die Wirbel unter Wasser. An das Tauchen, an das Seetang-Auffangen mit der nackten Haut, aber auch an diese kargen in Asturien gestrandeten, metallbauenden Gesichter unterhalb der kalten kantabrischen Gebirgskette, die aussehen, wie man sich die Gesichter jener vorstellt, die es schafften, nach jahrzehntelangen Bemühungen so beharrlich gegen die Römer anzutreten.
Dann wurde mir schwindlig und diese groteske Fahne erschien mir immer größer.
Ich hatte die Bilder dieser Küstenlandschaft schon auf verschiedenen lächelnden Instastories gesehen und nun kam ich dort an und erfror und erschrak vor den vielen Ratten, denen die Einwohner dieser Region schon architektonisch, in Bauten, die sich im Laufe der Jahrhunderte den keltischen Bedingungen angepasst haben, auszuweichen gelernt haben. Zum Glück erhielt ich zwei Wochen später die Einladung eines Freundes, der mich für ein paar Wochen zu sich in eine verlorene Region Extremaduras einlud, wo er, wie es hieß, ein recht komfortables Ferienhaus geerbt habe und dies mit Freunden feiern wolle, und ich war, ohnehin ermüdet von Apfelschaumwein und Seepocken, ohne langes überlegen dieser Einladung gefolgt. Wahrscheinlich hatte ich das nur getan, um mich von irgendwelchen Menschen zu umgeben, die über etwas, das ich nicht entschied, reden konnten, egal ob diese ihr Imkerhonig-Frühstück zigmal betonten, Straßenkatzen mit Haschisch fütterten oder überall, egal ob beim baden, beim essen oder beim urinieren, die Armut idealisierten. Wie dem auch sei, aus Asturien sollte bald Las Hurdes werden, und ich muss sagen, als ich diese Einladung las, da dachte ich, das Wetter wird bestimmt gut werden und die Bäche sind dort alle bekanntlich frisch und bekömmlich, also alles andere wird sich schon von selbst ergeben.
Jemand habe LSD mitgenommen, hieß es in der Nachricht zusätzlich.
Man würde auf mich warten.
Man kann das ruhig Verdruss nennen. Wir nahmen alle, unter den Korkeichen liegend, nur diese dämlichen LSD-Pappen, um in der Natur Effekte zu erzeugen, die man in der Natur gewöhnlich nicht finden kann. Größtenteils meines unerträglich überbordenden Trips konnte ich allerdings nur an diese eine unheimliche Doku von Luis Buñuel denken: ‚Las Hurdes, Land ohne Brot‘, würde diese auf Deutsch übersetzt heißen. An diese vor der Schule sterbenden Kinder, die man dort auch heute noch nachweinen kann, musste ich denken, während ich mich immer einsamer und verlassener und verlorener auf dieser Erde vorkam, die Hände gegen den Boden presste, mit den Fingern in den Kies bohrte, mich fühlte, als hätte ich nicht genug Fingernägel, um mich festzukrallen, um fest an der Erde gebunden zu bleiben, in der Angst, für immer in den zum heulen eisigen Tod hineinkatapultiert zu werden. An diese schiefen, heizungslosen Tonschieferhäuser. An diese zermalmten, von Karies durchlochten Zähne. Und an diese surrealen, manchmal auch von Würmern übernommenen Esel als gängige Traum-Symbolik Luis Buñuels — auch an diese musste ich denken.
Wie auch immer, dieser Freund, von dem ich erzählt hatte, wollte eine Woche später auch noch nach Valladolid fahren, um sein Philosophie-Master-Abschlussdiplom abzuholen, wie sich während der Fahrt dorthin feststellte, als wir an einer Tankstelle warteten, vor dem Mitsubishi, und er meinte, er würde sich einen Tesla zulegen, da seine Eltern nach seinem Master-Abschluss, wie er oft wiederholte, seinem Master-Abschluss, endlich großzügig geworden seien. Diese Großzügigkeit wolle er nun mit mir feiern, sagte er, immer wieder, wie er bereits in Extremadura wiederkehrend gesagt hatte, mit mir feiern, indem er mich zum großzügigen trinken einlade. Wir kamen also bereits ziemlich berauscht in Valladolid an und er führte mich, gemeinsam mit anderen wortlustigen Gesellschaftsonanisten, die er zu kennen sagte, in eine Bar namens Wittgensteins Beer. Dort betrank ich mich vor lauter gesprächigem Antikapitalismus bis ins Peinlichste, und wurde so wortlustig, dass ich allen erzählte, ich sei mit dem ‚Anführer der deutschen Linken‘ verwand. Gregor Gysi, sagte ich zu diesem dicklichen Typen, der ein Trikot der Nordkoreanischen Fußballnationalmannschaft trug, Gysi sei mein Nachname.
Hier, in dieser Bar übrigens, und nun komme ich drauf, umgeben von Diskussionen über privat und öffentlich, stellte ich endlich fest, dass ich das, was ich in Madrid gesehen hatte, immer noch nicht vergessen konnte.
Also, um wieder auf den Anfang dieser Reise zurückzukommen: ständig, ständig während diesem ersten, spanischen Teil meiner Ferien, ständig vermied ich, ständig, Madrid. Bis zum letzten Tag vor meiner Abreise nach Kopenhagen würde ich nicht mehr Madrider Boden betreten. Ständig durchlebte ich mein eigenes billiges spanisches, zu Spanien angepasstes, durch Madrid zentralisiertes Faserland, sah es beschrieben in diesen Volkspartei-Nasen überall, in diesen überlasteten Einkaufstüten, in diesen Adels-Zeitungsartikeln, zudem noch überall diese verbitterten, reichen Drogenpapis und -mamis, dieser verwöhnte Altbauerbenspaß, überall dieses grundlos von der Geschichte bereits in die Körper hineingeschriebenes Spanien, dieses Mediaset-Spanien, dieses Franco-Staudamm-Spanien, dieses Spanienarmband-Spanien von das man sich nur kaputtsehen kann.
Und erst hier fing ich an, Eurotrash zu lesen.
Ich las die ersten Seiten, als ich in das Flugzeug in Richtung Kopenhagen stieg. Es war auch schon Oktober und es führte mich, man könnte sagen, gezwungenermaßen verliebt, nach Kopenhagen. In irgendetwas verliebt, glaube ich, zog es mich nach Nørrebro zur Lyrikerin, zu ihrer Bob Dylan Plattensammlung und zu ihren ausweichenden Gefühlen. Tage später, ich springe jetzt sehr schnell von Ort zu Ort, besuchte ich den schreienden Mitbewohner bei seinem Barbour-Jacken Praktikum in Hamburg, und Faserland schien mir, obwohl ich nun überall Parallelen sah, immer entfernter. Dann, entschuldigt die demotivierte Aufzählung, kam dieser horrende Flix-Train-Party-Zug nach Berlin, in dem zehn Blonde mit einem Kasten Bier nicht aufhörten irgendwas mit Uschi zu schreien. Und in Berlin, in Berlin angekommen, wurde es nur noch säder, mit den Tonis und mit den Theos, mit diesen erstarrten KulturwissenschaftlerInnen, die nur noch Speed ziehen und hyperironisch Schlager singen. Und hinterher noch Leipzig, trauriger denn je, zu Besuch bei der an Überforderung verlorenen Ex in ihrem grauen Ein-Zimmer-Studio-Apartment, sie mit dem Snoopy-Schlafanzug, mit ihrer Bodenheizung, mit ihrem grünen Leguan. Schluchzend lag sie stundenlang an mich gepresst, woraufhin ich natürlich mitweinen musste. Oder Ende Oktober, zurück in Oberbayern, bei dieser Hochzeit, an der ich nur noch in einer Ecke sitzen wollte und an diese immer wiederkehrende Großstadt-Sekunde denken konnte, die es braucht, bis man auf das Grün-Werden der Ampeln reagiert. Oder, nun der letzte Stop, schließendlich, Venedig, eine Stadt, die trotz den vielen Holzpfählen meinen Körper nicht mehr tragen konnte. Venedig, wo ich einer Einladung meiner Tante gefolgt war. Tante, liebevolle Tante, herzhafte Tante, mütterliche Tante, so weit entfernt vom kirchendurchstochenen Hildesheim, Venedig, Ort meiner Corona-Infektion.
Und dazwischen, auch das darf man nicht vergessen, ich. Ich, immer trauriger und immer enttäuschter. Um Gottes Willen: immer absurder das ganze Getue, total verloren in den wechselnden Ortschaften und Gesichtern, in Gesprächen immer meinen trägen Zustand zum Ausdruck bringend, und alles, was mir dabei entgegenkam: nur schreckliche Mode-Psychologiewörter. Ob Zyklothymia. Ob Impostor-Syndrom. Und dazwischen ich, wie gesagt, immer erschöpfter von solchen Begegnungen.
Aber, wie gesagt, es soll ja hier um Eurotrash gehen, um dieses Eurotrash, nicht um jenes eigens erlebte, personalisierte Krachtland, nicht um jenes. Aber auch um jenes.
***
Wo fehlt sie nicht alles, hier, die Schlauheit, dachte ich mir, in Berlin, als ich diesen Text fertiggeschrieben hatte. Wo ist dieses Bittere im gleichsam koketten und diskreten Anzug? Wo ist, sagen wir mal, dieser snobistische Radau, diese junge Wucht Faserlands? Wo bleiben die scharfsinnigen, in sich geschloßenen, pointierten Bemerkungen Krachts? Man kann förmlich spüren, wie bei mir alles nur versucht ist, wie versucht es ist, wie versucht wird, dass am Ende jedes Absatzes etwas abgerundet wirkt, dass der Text gefüllt ist von Schlagwörtern, die sogleich alles aussagen. Ein einzelnes Wort glich damals, in Faserland, einem aufrührenden Fingerzeig —Bordbistro, Barbourjacke, SPD-Nazis. Auch heute, in Eurotrash, gibt es diese Schlagwörter, auch wenn, wie soll man sagen, man will ja sowas als junger Kerl nicht sagen, es da etwas gibt wie, sagen wir mal, sehr viel Nachsicht. Das heißt: Meine fehlende Schlauheit zeigt sich in der Abwesenheit von sowohl Fingerzeig wie Nachsicht. Dazu kommt obendrein: dieser zur Natürlichkeit hin konstruierte, konsumtraurige Dandyismus der Kleidungsstücke und der Taxifahrten, den man bei Faserland las, und den man in Eurotrash auf veränderter Weise begegnet, bleibt selbstverständlich bei mir aus. Was ich damit meine, wenn ich behaupte, dass man diesen Dandyismus auf veränderter Weise begegnet, ist: Heute liest man ihn als Kommentar, erlebt man ihn als Familiäres, darüber hinaus stellt er sich gegen sich selbst — man könnte etwas Frech sagen, ihm hat das Alter gutgetan. Er lebt sich so aus, dass er den Erzähler dazu führt, gemeinsam mit seiner daueralkoholisierten und -medikamentierten Mutter ihr in Aktien gewonnenes Waffengeld zu verteilen — der Dandyismus ist also revanchierend und kathartisch großzügig. Und, was noch dazu gesagt werden muss: Faserland war Trendsetter, mein Text ist höchstenfalls manieristisch. Damals ließ Kracht kühn und charmant, wenn nicht auch gallig eine sogenannte Pop-Literatur aus sich entstehen, wie man ja so schön sagt. Schön wäre es, wenn das hier einen neuen Literatur-Kritik-Trend auslösen würde. Aber, wenn es schon nicht so passiert, dann könnte es zumindest etwas von Eurotrash haben.
Das soll nicht falsch klingen. Eurotrash hat Faserland nichts nachzutrauern. Was heute hinzukommt, hat mit dieser vorhin erwähnten Nachsicht zu tun. Ihr Schlüssel liegt in der Vergangenheitsform, die im Kontrast steht zum Präsens ihres Vorgängers. In ihr spielt sich eine kluge Art von Distanz ab, die eine offensichtliche Auseinandersetzung mit Wahrheit und Fiktion, Realität und Erzählung darstellt, eine Reflexion aus Sicht des Schriftstellers von Faserland, der gleichzeitig Teil der Konstruktion einer neuen Fiktion wird. Und wie er das schafft.
Ich habe das vorhin anders gesagt, nun spreche ich es einfach mal so aus: einem vergeht das Lachen, wenn ersie Eurotrash liest. Das Schlimmste und zugleich Schönste ist aber leider, dass einem dieses Lachen immer wieder vergeht, da man immer wieder lachen muss. Aber wie schlau nur dieses Lachen erzeugt wird! Wie wäre es nur möglich, dieses bitter-humorvolle Element, wie würde er nur erzeugt werden, dieser Humor, der so humorvoll weh tut, ohne der Figur der Mutter. Sie ermöglicht es von trübsinnigen Monologen in reizvollen Dialogen zu übergehen. Sie ist da, um den gemeinsamen, spontanen Road-Trip mit intergenerationalem Austausch zu füllen. Die Passagen über die Traumata der Kindheit, die Kracht erzählt, bekommen erst die Wirkung einer sich unendlich wiederholenden Geschichte, wenn man die Passagen über die Traumata der Kindheit seiner Mutter liest. Die Mutter verwandelt alles, und das merkt man, sobald sie da ist. Sie ist beispielsweise der Anstoß für die detailreiche Beschreibungen der Familie Kracht, durch sie werden die Rückblicke auf die Zeit der Niederschrift von Faserland also zu einer familiär gebundenen Erzählung, und das allein, wirklich nur allein aufgrund ihrer vermuteten oder gelesenen Anwesenheit. Und, na ja, wäre da nicht die Mutter, dann wären auch nicht die vielen Geschichten, welche die fiktive Figur ‚Kracht’ seiner Mutter erzählt, um sie aufzumuntern, zu unterhalten oder schlicht am Leben zu halten. Dazu werde ich allerdings noch später zu sprechen kommen, denn das ist sehr wichtig, sehr wichtig.
Also, all das, was ich gerade über Eurotrash geschrieben habe, hat bei mir gefehlt. Dialoge gab es bei mir selbstverständlich nicht. Eine Mutter auch nicht. Darauf hätte ich erst kommen müssen. Man könnte auch sagen, all das hat bei Faserland gefehlt (auch wenn das sehr schief formuliert wäre und strenggenommen ganz, ganz falsch ist). Eurotrash ist kein zweites Faserland, das kann man auf jeden Fall so sagen. Wie gesagt, ist er nicht schlau, der Bursche? Ja, eine Ode an die Schlauheit.
„Fast ein halbes Jahrhundert ist es her, strahlende, europäische Welt“.
In Berlin dachte ich mir, ich sollte versuchen eine Klappentext-Kritik zu schreiben. Wenn es Kehlmann geschafft hatte, warum nicht ich. Wenn sie Handke in den Mund gelegt wurde, warum nicht mir. „Ach, Eurotrash, Eurotrash!“ zum Beispiel, oder: “Ein Vierteljahrhundert später setzt Kracht neu bei Faserland an“, oder: „Es beginnt eine neue, spannende Reise, diesmal nicht von Sylt nach Zürich, sondern innerhalb der Schweiz“, oder: “die Schweiz als neuer Schauplatz, die Schweiz als Ausgangspunkt der Durchforschung eines vergangenen und gegenwärtigen und eines in all dem festgefangenen Europas“, oder: „ein halbfiktionalisierter Kommentar zu Faserland“, oder, um mal ins Kehlmännische überzuspringen: „eine Reise durch die Schatten und Geister einer Familie, Sinnbild einer allgemein gegenwärtigen Vergangenheit“. Weil ich auch so viel Lust auf Spaß hatte an dem Tag, schrieb ich zu guter Letzt: „Eurotrash, etwas im Grunde, egal wie man es sieht, verdammt Unwitziges. Man liest es und bekommt einen schlechten Magen“. Und das stimmt, denn es enthält die perfekte Mischung aus außerirdisch Kaltem und unheimlich Warmem.
Ja, vielleicht eher das.
Was von diesen Überlegungen an diesem Tag in Berlin letzten Endes überlebte, war allein das Gefühl der Überforderung, welches diese schwer zu fassende Schlauheit in mir erzeugt hatte. Das sage ich, weil ich ab nun nur noch einen Schlag auf meiner Brust verspürte. Die Faust, geballt. Ein Krampf im Bauch. Kurze, sich auf Fingerspitzen heranschleichende Panik — schon wieder diese Panik —, wie wenn man gerade einen Witz teilt, von dem man ahnt, dass er nicht witzig ist, weil da so ein Hintergrund ist, der grauenvoll ist, der schrecklich unlustig ist, der nie voll und ganz präsent ist und dennoch omnipräsent bleibt, wie, dachte ich mir, im Lachen jener Gruppe Obdachlose im Park, die ich aus der Fensterküche sehen konnte, in Berlin-Mitte, im Herbst, da am Volkspark am Weinberg, ein lautes Tönen aus der Ecke, auf den Bänken, und ein übertönendes, betrunkenes Lachen, des Übertönen willen. Überall diese lustige, lustige Welt, auf das Jetzt gemalte, im Jetzt eingeschlossene Vergangenheit, strahlende, europäische Welt auf der ewigen Suche nach Morphium und Baldrian und der verlorenen Zeit.
Die Zeit. Endlich ist sie da, die Zeit.
„Ich sagte, jetzt gleich, wir tun es jetzt, es mache keinen Sinn, zu warten. Es sei der erste Schritt. In girum imus nocte et consumimur igni. Entweder wir würden uns immer weiterdrehen in der Nacht, verzehrt vom Feuer, oder wir gingen, und zwar jetzt.“
Ach, es gibt da so vieles, das in meinem Text fehlt! Ein Grundpfeiler dieser Schlauheit, so fiel mir in der Küche nun ein, und ich hatte dabei meine Corona-Erkrankung schon gänzlich vergessen, wenn nicht der Grundpfeiler dieser Schlauheit, die in Eurotrash so überbordend zu spüren ist, ist gerade dieses eine Wort: Die Zeit. Aus diesem Wort lässt sich alles schöpfen, was in meinem kurzen naja-Pastiche fehlt, und was Eurotrash grundlegend von Faserland unterscheidet. Kein schlechtes Thema, die Zeit. Endlich, denn es ist, so spät ich auch darüber zu sprechen komme, das, was diesem Roman durchdringt und durchweht, was ihn als solchen so erschütternd macht und was aus Kracht, im Vergleich zu meinem kurzen Pastiche, einen so schlauen Burschen macht. Das Erleben der Zukunft, der Vergangenheit, der Gegenwart, es findet in diesem Buch nämlich in Unmöglichkeiten, in Satiren, wie auch in Möglichkeiten und in ausbrechenden Kräften statt. Was Eurotrash, in Relation zu Faserland, hinzugewinnt, ist beispielsweise eine deutlich verstärkte Nostalgie. Sie tritt auf in mehreren, schlau in Tee getunkten Madeleines. Sprachlich raffiniert reist der Erzähler länger in die Vergangenheit. Er taucht tief in ein Interieur ein. Diese Vergangenheit ist jedoch keine Illusorische, kein Weg in die Evasion. Was diese Vergangenheit letztendlich ist, ist eine Erzählung. Sie bedeutet ein Spiel mit der Zeit, die Linien wirft und entwirft, diese in allen zeitlichen Richtungen ausbreitet, und die Knoten bindet, die nicht mehr zu entknoten sind. So bieten sowohl die schwerwiegenden Erinnerungen und Traumata, oder die Vorstellungen einer Zukunft, wie auch die wiederkehrenden erfundenen Erzählungen des, verzeihen sie die Tautologie, Erzählers, eine zeitliche Möglichkeit. Was im Erzählen versucht wird, ist den Kreislauf der Geschichte zu unterbrechen, den ewigen Kreis zu durchbrechen. Das Geschichten-Erzählen wird somit zu einem mächtigen Werkzeug der Zeitlichkeit. Und diesen spürt man immer mehr und immer intensiver im Laufe der Lektüre.
Was das Erzählen angeht: Eurotrash ist an mancher Stelle ein moderner Don Quixote. Ich wage es zu sagen, Eurotrash ist eine Parodie der verrückten, spaßgesellschaftlichen, abgewrackten Roadtrip-Bücher alla Tschick oder, weiß der Geier, Der Hundertjährige der soundso. Das Spiel zwischen Wahrheit und Fiktion, genauso wie das Hinzufügen von kurzen Geschichten im Verlauf einer Handlung, macht diese Don Quixote-Referenz nachvollziehbar. Und die Mutter hat, beispielsweise, manchmal etwas von einem Sancho Panza, unter anderem als sie den Fiktionskracht, diesen Ritter der tristen Gestalt, sogar ins Innere einer Kommune folgt, welche Sie, aufgrund seiner Erzählung, für ein Hotel hält. Das Geschichten-Erzählen erhält etwas Heilbringendes. Und Geschichten innerhalb von Geschichte dienen nicht nur der Unterhaltung, sondern helfen auch den Figuren, wie auch den realen Personen, zum Aufwachen und zum Imaginieren schräger und schriller Realitäten, aus denen neue Realitätsgeschichten geschöpft werden können. Die Realität, die reale Welt, bleibt verworren mit der Fiktiven. Niemand ist verrückt und niemand heile. Und hier fängt nicht nur die Zeitlinie zu verschmelzen an und sich in etwas rhizomatisches zu verwandeln, sondern hier fängt auch die Welt an zu welten, auch die Welten fangen an, auch die Weltenwelten. Am Erstaunlichsten wird es, als der Erzähler, also der fiktive Kracht, die vierte Wand bricht. Er wundert sich darüber, wie es möglich sei, dass er wisse, was in der Restaurantküche geschehe, wo er sich nicht in der Restaurantküche befinde. Anderorts heißt es sogar: „Wußtest Du, daß wir gerade in einem Buch beschrieben werden? Wie bei Cervantes?“.
Brüche mit der vierten Wand können heikel sein, wenn sie grundlos eingesetzt werden. An dieser Stelle jedoch, Herrgott, in jenem Kontext, enthält dieser Bruch so viele Ebenen, dass man die Kracht-Maske fallen lassen muss und sich vor diesem Ritter verbeugen muss, wenn nicht sogar ihm die Füße küssen. Der Grund?
Peter: Die Schlauheit.
Und nun, vergleichen sie mal die Person, die ihnen in meinem kurzen Exkurs begegnet ist, mit den Figuren Krachts in Eurotrash. Vielleicht mag folgendes sehr nach SPD-Nazi klingen, aber was man auch absorbiert, im Laufe dieser Erzählung, ist sehr viel Respekt. Ich meine, Respekt vor dem Schreiber, aber auch Respekt vor diesen Figuren, vor diesen Menschen, wenn nicht sogar eine Art Demut, eine besonnene Demut, eingefleischt in einem anthropologischen Blick. Respekt gegenüber dieser alkoholisierten Mutter und den Erfahrungen ihres Lebens; Respekt gegenüber der Erbärmlichkeit dieser Welt; Respekt gegenüber der Fragilität der dünnen, grausamen Lebenslinien; Respekt gegenüber der kurzen Dauer dieser Existenz und das leider Gottes seltene, wahre Lachen; Respekt gegenüber der Traurigkeit und den missglückten Formen der Unterdrückung jener Traurigkeit. Das Erzählen — ich hoffe ich wiederhole mich nicht allzu sehr — bekommt hier also ein spezielles Gewicht, und die Gewichtung der Vergangenheit liegt im Jetzt.
Erzählen bedeutet bei Kracht also nicht nur eine einfache Flucht. Kein Fliehen, keine Evasion fasst dies in Gänze zusammen. Das Erzählen bedeutet hier ein Akt der Potentialität, die Erschaffung einer Möglichkeit, das Brechen der starren Linie, die Immersion in das zeitliche Geflecht. ‚Erzähl mir eine Geschichte’ heißt, erzähl mir eine Möglichkeit, spreche mir in die und aus der Zukunft, erbaue mir eine Gegenwart aus und von der wabernden Vergangenheit. Das plötzliche Herausbrechen aus dieser Fiktion, wie wenn etwa ‚Fiktionskracht‘ meint, sie befänden sich in einer Geschichte, öffnet die Pforte zu einer neuen Fiktion, es ermöglicht die Bindung des Unbindbaren. Das Erzählen schafft es, die Mutter am Leben zu halten. Ich wiederhole: Kracht schreibt seine Mutter lebendig. Und was noch wichtiger ist: Kracht spielt hier über das Spiel.
Ich muss sagen, ich finde diese Raffinesse, diesen mit Effet geschlagenen Ball, der durch die ganze Erzählung fliegt und vom Torwart unberührt im Tor endet, extraordinär. Ich saß dort, in der Küche, öffnete das Fenster, um zu lüften, und dachte an diese eigenartige Geschichte. Sie machte mein Epigonentum kaputt, ich sah ihn am Boden verteilt, in Trümmern. Diese gemeinsame Reise, eine Handlung, deren Komik stets von einer so tiefen Niedergeschlagenheit durchtrieben ist, von einer so grausamen, unüberwindbaren Vergangenheit, dass einem schnell der Spaß vergeht. Dieses Ziel: eine letzte Reise mit der ins Leben geschriebene Mutter. Das schmutzige Geld mit aller Welt zu teilen, es zu verbreiten, das ganze Geld endlich loszuwerden, es zu verteilen, ein und für alle mal verteilen. Diese ewigen Kreise in der Zeit. Daran dachte ich, in der Küche, an dem Tag, an dem ich erfuhr, dass ich Corona hatte, setzte mich dabei wieder auf meinen Schemel hin, nachdem ich mir einen Kamillentee zubereitet hatte, und schrie in Ekstase: ein verdammt schlauer Bursche!
„Meine Güte, dieses Leben, was für ein perfides, elendes, kümmerliches Dramolett es doch war, dachte ich, während ich weiter an die Decke des Hotelzimmers starrte und sah, daß dies tatsächlich die ewige Wiederkunft war, unser Unvermögen, der Zeit einen Anfang zu setzen, aeternitas a parte ante, wie es mir einmal ein Geistlicher in Florenz zu erklären versucht hatte. Sollte es aber gelingen, den Kreislauf der Geschichte zu unterbrechen, dann könne man nicht nur die Zukunft direkt beeinflussen, sondern auch die Vergangenheit.“
(Bis bald)