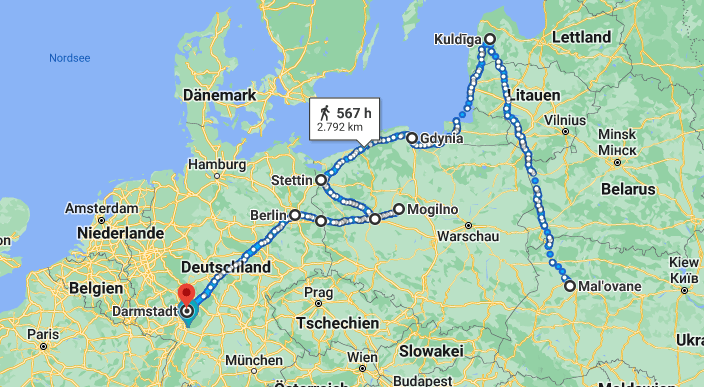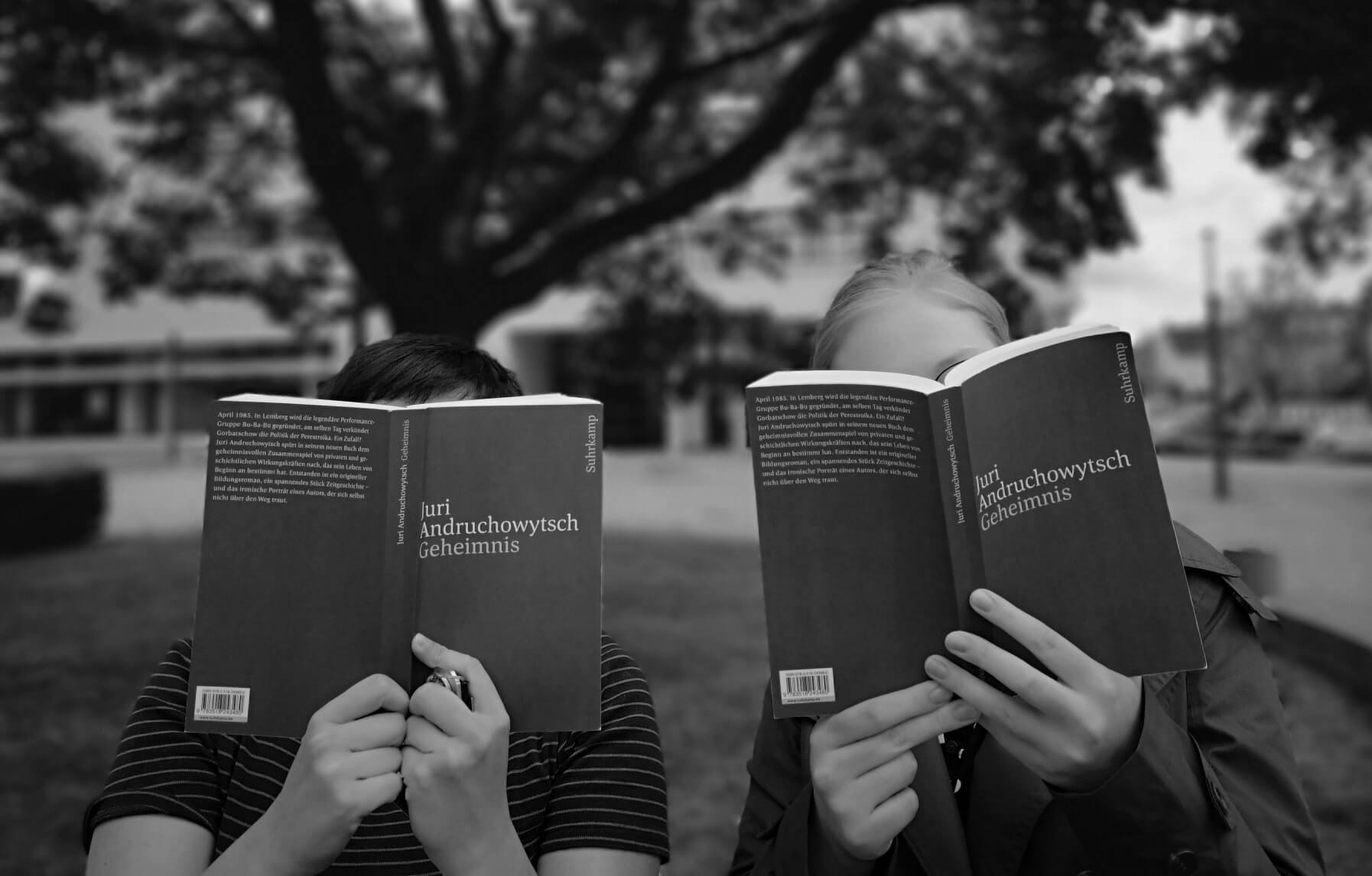Nah ist nicht falsch.
Grau ist nicht kühl.
Wir sind nicht
Neid ist nicht faul.
Tag ist nicht Schwamm.
Fierce ist nicht fern.
Kram ist nicht blau.
Cool ist nicht cut.
Mond ist nicht ich.
Zeit ist nicht gar.
Im Rieseln der Nadeln stehe ich still und warte auf nichts.
Zu Ende mein Verlangen
(Biagio Marin, 1983; übersetzt von Peter Waterhouse)
das Herz ist erfüllt
das Licht empfangen
und das Auge gestillt
So viel betrachtet
gesehen, geliebt
arm geblieben
mein Herz ist nackt.
Ich besitz
den Tod und das Helle
Verwandlung zu nichts
unvorstellbar.
Go n’eirigh an bothar leat.
May the road rise to meet you
Die Schnur sprengen, die Zäune biegen, das Kontinuum negieren, das logische Ei tanzen, das Vergessen vergessen, den Sätzen folgen, indem sie vergessen werden, die sich in sich selbst nie wiederholenden Sätze überspringen, über die Kopula nach vorne preschen, die Strukturen gelenkig machen, die Palindrome vergessen, die Buchstabenhaut spiegeln, die Spiegel aufrauen, den Krebs rückwärts gehen lassen, die Partitur aus Holz doppeln, das Nützliche verlieren, das Vergessen bezeichnen und im voraus erinnern, das Double verinnerlichen, das Unding machen, den Unsatz lesen, das Emergente überspringen, diesen Schritt wiederholen, den nächste Schritt auch wiederholen, den vorherigen Schritt wiederholen, die Emergenz gewähren lassen, die Schwerkraft deklinieren, die Katastrophe der Synthese benennen, die kontinuierliche Katastrophe verlieren, die Fuge besamen, die Semantik flechten, die Ahnen schwirren lassen, die Düne aus Gold verraten.
Die Rede und die Sprache und das Wort und der Satz sind Ziegelsteine und die Pausen, umgeben von Farn und Spinnen, die Grenzen verkleidet, in der Form von Sätzen, als unbekleidete Gedanken, als fremde Rede, als ein Drittes, als das, womit du sprichst und nicht ich, was außerhalb verbleibt. Die Rolle dieses Anderen, die bedingte Rolle, die Bedingung als Ganzes und Richtung zugleich, die bedingte Andeutung als Stil und Konvergenz mit der Gegenwart, als Verflechtung mit der Vergangenheit des Eigenen und Fremden im Gesagten oder Geschriebenen. Die Intimität der Antizipation des Fremden, die Obertöne dann, ein steter Wechsel und der Übergang zum Satz. Dessen rahmende Losigkeit als Problem seiner Bedingtheit, seiner Wirklichkeit, seiner Besonderheit, als Bedingung seiner Kollektivität. Die Wirksamkeit als Wirklichkeit und als Situation. Die Bedeutung, die es immer noch nicht gibt.
Nawalny kann, als er aufwacht, nicht sprechen. Er kann: atmen. Die Augen öffnen und schließen. Die Zunge im Mund bewegen. Den Kopf langsam zur Seite drehen. Die rechte Hand heben, die linke nicht. Die linke Hand mit der rechten nehmen. Die Füße bewegen. Er versteht, was die Ärzte zu ihm sagen. Alle sprechen mit ihm. Die Hand seiner Frau auf seinem linken Arm spürt er nicht. Er weiß, was er auf die Fragen der Ärzte antworten möchte, aber die Wörter, die ihm einfallen, scheinen nicht zu passen. Die anderen, die, die er braucht, sind außer Reichweite. Er schweigt.
Alles leuchtet, als würden wir alles nur von innen sehen, auf schmalen Buchstabenfüßen, an grauen Rändern entlang. Die Seiten, wie die Felder links und rechts, verharren. Geweißt, Löcher in der Welt. Die Fäden der Wege verwechseln die eine Welt mit der anderen, ohne Zorn und Absicht, wo wir die Pausen hören, den wiederkehrenden Übergang, wo was in was noch übergeht, den Abstand als die Möglichkeit des Anderen, das immer größer wird und Nachbilder einsammelt, durchsichtig, inwendig durchlässig. Verschwinden wird das in diesem Weiß, in einem ortlosen Gang, in dem ein Stab nur noch eine Spur sein kann, eine Zeile für Verlust, eine porös, eine ohne Geheimnis, eine mit Zuversicht, eine schweigt, eine schutzlos, eine ein Name, einer unter vielen, eine die Aufmerksamkeit, eine der Schatten und eine der Weg aus nichts.
“Die Sprache muss zwangsläufig auf (…) Abwege geraten, und jeder Abweg ist ein tödliches Werden. Es gibt keine gerade Linie, weder in den Dingen noch in der Sprache. Die Syntax ist die Gesamtheit von notwendigen Abwegen, die stets von neuem geschaffen werden, um das Leben in den Dingen sichtbar zu machen.”
Gilles Deleuze
Abwege führen nicht irgendwohin, sondern kreuzen sich, laufen parallel, akkumulieren sich, spannen den Raum des Syntagmas aus. Das ist der Raum, in dem wir atmen. Also schreiben und lesen, in dem wir Pausen machen und einen neuen Anlauf nehmen, in dem wir springen und aus ihm heraus, um andere Räume zu verknüpfen, zu durchkreuzen. Syntax schafft temporäre Strukturen, die andere zerstören und, indem sie zerstören, sich erschaffen.
Nichts zu schöpfen. Was erst geschaffen sein soll, ist nicht da, um daraus mit was für Behältern zu entnehmen, wovon dann was übrig bleibt? Wechselseitig besprechen wir das und tragen in den Transformationen Narben davon, die halbverblasst und fremd dann Formen sind. Formen wie Flächen, die einander in funktionaler Vielfalt überschneiden, typisiert irgendwann, doch unterhalten sie noch eine Beziehung zu denen, die sprechen und schreiben und hören und lesen. Formen, die Mittel und Objekt zugleich sind, Bild und Absicht, ihre eigene Grenze als Bedingung der Form, die immer ein Übergang der Sprache ins Sprechen ist (Bachtin).
Also zersetzen. Nicht zerstören. Springen will ich nicht. In welche Sprache? Wo könnte ich ein gutes Gewissen haben, wo werde ich lügen, wo kann ich gleiten, ein paar Sätze festhalten und mit mir ziehen? Wo kann ich ein sprödes Sprechen üben, ein paar Affekte, die funkeln und brennen und befreien? Von ihrem Duft werde ich nicht sprechen können. Auch dosieren werde ich sie nicht können. Verzehren muss ich mich, hungrig, eifersüchtig, ausschließlich. Wo sind sie entwichen, so rau und offen, dass ich die Bezeichnungen fassungslos türmen muss? Als wäre da in den Wörtern etwas enthalten, das ich geben kann, ohne einen Willen, das von mir Besitz ergreift und ich doch nicht finden kann. Was ich wiedergebe, löst sich ab, ein einfarbiger Schatten, eine Windung, eine Verlagerung.
Ablösen, ja, ins Viele drängen, zerstreuen, vervielfältigen: die Langeweile aller Dualismen, ihre Sinnlosigkeit. Dagegen arbeiten wir mit Unterscheidungen und Unterscheidungen von Unterscheidungen, schreiben also Texte: “die Differenz tritt wie ein Zerstäuben auf, wie eine Verstreuung, ein Sichspiegeln” (Barthes). Die Verlagerung hält, was sich bewegt, in der Schwebe und macht es uneindeutig. Der Schritt der Gradiva. Was eben angehoben wurde, kommt nun an einen anderen Ort, für einen Moment. So geht es fort. Bemerkenswert ist vor allem der Zwischenschritt, das Heben und Senken, ein Spreizen, die Bewegung vor und nach dem Abdruck, den ein Schritt möglicherweise hinterlässt, im Lesen wie im Schreiben, im Spiel der Finger auf der Tastatur. Dabei scheint es, als sei die Bewegung, als sei dieser Prozess ohne Halt, unaufhörlich. Tatsächlich besteht er nur aus Halten. Ein unentwegtes Halten, Anhalten, Innehalten, das aber immer wieder neu ansetzen muss, da jeder Halt nur von begrenzter Dauer sein kann. In jedem Halt wird angesammelt, Atem geschöpft, repariert, die Kleidung gewechselt, nur um weiterzugehen.
Das Einhalten einer bestimmten Körperhaltung gegen die Wirkung der Schwerkraft hängt von der Zahl der Beine ab. Je geringer deren Anzahl, desto größer der Aufwand für die Kontrolle der aufrechten Haltung. Zumindest für Zweibeiner gilt deshalb: Laufen ist kontrolliertes Fallen.
online Lexikon der Neurowissenschaft
Jede dieser Unterscheidungen und Schattierungen kann leuchten und von größter Präzision erscheinen, jeder Strich und jeder Baustein, jeder Anschlag. Zugleich sind die so geschriebenen Sätze voller Fehler, ist jede Wiederholung anders als die andere, um keine tote Wiederholung zu sein. Jede dieser Unterscheidungen ist diesen Sätzen voraus und hinterher, denn sie will, sie muss etwas verlieren. Es geht um Leben und Tod, um die Starre des Textes, um die Richtung der Rede, um die Drift ihrer Lust.