Clemens J. Setz: Die Bienen und das Unsichtbare
“(…) Es ist, als sagte es mir etwas, und tatsächlich beugt es sich dann vor und blickt mir ins Gesicht, um den Eindruck zu beobachten, den die Mitteilung auf mich gemacht hat. Und um gefällig zu sein, tue ich, als hätte ich etwas verstanden, und nicke. Dann springt es hinunter auf den Boden und tänzelt umher.” Es ist dieses Tänzeln, von dem mein Buch handelt. Es ist unsere eigentliche Natur.
Über Kafkas Erzählung “Eine Kreuzung”
Es ist die Zeit der Windows XP, eine Ära der noch verkabelten Mäuse und voluminösen, klackenden Tastaturen. Ich sitze als kleines Kind vor dem Computer und versuche ein Word-Dokument zu Ende zu formatieren. Der PC-Ventilator surrt; am unteren, rechten Eck des Bildschirms erscheint ab und an eine hüpfende Büroklammer. Im Zimmer ist es fürchterlich heiss, doch in den Tiefen dieses Dokuments ist die Welt frisch und fröhlich, bunte Farben: die Buchstaben werden von der abgerundeten Elite der Comic Sans versüßt, alle Wörter ignorieren die rote Linie, die sie unterstreicht, um auf eine unrechtmäßige Zusammensetzung hinzuweisen, es herrscht alles in allem eine blumige Stimmung, die Welt wird verändert.
Mit den Fingerspitzen beider Indexfinger trete ich gegen die sommerliche Hitze Madrids an. Ich schreibe im Rentner-Pace Buchstabe für Buchstabe das Wort ‘Feliksiano’ nieder. Ich tobe mich, bis der Zauberstab mich auserwählt hat, in verschiedenen WordArt Schriftarten aus. Schließendlich lasse ich mich erleichtert in die Rückenlehne fallen. Das Word mit dem Titel ‘ks’ ist gespeichert. Und nun? Nun rufe ich nach meinem Vater, überlasse das geheime Werk dem vertrauten Buchbinder — dem Autor selbst sind die ominösen Ranken und Windungen des Canon-Kosmos noch nicht vertraut — und warte darauf, bis etwas geschieht. Ist es schon in der Presse? Ich bin nur wenige Sekunden davon entfernt, eine neue Sprache in die Welt zu setzen.
Alles Schmarren. Aus ‘Feliksiano’ (abgekürzt ‚ks’) ist nie etwas geworden. Feliksiano ist nur die Erfindung eines nasenwühlenden Puppenspielers, eine Revolte der Konsonanten, ein zügelloses Warum-auch-nicht. Es gab kein System, es gab nie Sprecher, es gab nur ideale Wortklänge und Wirrnis, all dies vereint in einer transformierenden Idee: die Kreation einer universalen Sprache aller Stofftiere. Feliksiano war eine Plansprache — mit einer sehr vagen Struktur. Sie nahm Elemente der spanischen, englischen und zum Teil auch deutschen Grammatik (oder das, was ich damals unter Grammatik zu verstehen dachte), blieb aber größtenteils ein peinlicher Zusammenstoß von Zufall und Lachkrampf: ein auf die Tastatur geschlagenes Asdfghjk. Was dahinter lag, war aber der Impuls, der besondere Reiz, eine Sprache zu erfinden, eine eigene Sprache zu haben, einen neuen Weg zu öffnen, um mit Stofftieren zu kommunizieren und um denen, die immer still in der Ecke des Schlafzimmers saßen, zu ermöglichen, mit mir in Austausch zu treten.
‚Ks‘ soll hier nur ein einführendes Beispiel zu einer erfundenen Sprache sein. In erster Linie ist Clemens J. Setz’ Buch eine Erforschung erfundener Sprachen, eine Untersuchung von Plansprachen von Bliss-Symbolics bis Volapük. Der Raum von Setz’ Inspektion lässt sich aber nicht so leicht begrenzen, er wächst in der Lektüre immer weiter, geht Hand in Hand mit einem metaphysischem Interesse. Aussprache, Verstand, Spiel. Erfundene Sprachen sind nun ebenso revolutionäre Utopien einer Weltsprache unter einer vereinfachten, „global“ verständlichen Grammatik, beispielsweise Esperanto, wie auch nonsensische Formen des lyrischen Ausdrucks, elementare, partikuläre Sprachweisen einzelner Lebensschicksale oder längst vergessene Bruchstücke eines unerhörten Versuchs, in Kommunikation zu treten, nun aufgefunden im letzen Winkel eines Internet-Portals.
Sprache ist hier die Notwendigkeit zur Sprache, die Suche nach Sprache, die Sucht nach Sprache, die Hoffnung nach Sprache, die Lust auf Sprache und immer wieder eine große Unmöglichkeit, das Eigene vollends in die Außenwelt zu übertragen, das Innere zur Gänze zu veräußern, neue Wege zu finden, das, was in einem ist, ins Veräußerte zu übersetzen. Am Beispiel eines Auszugs aus Kafka’s Eine Kreuzung, wo der Protagonist ein Tier besitzt, halb Lamm, halb Katze, das ab und an mit dem Besitzer zu kommunizieren scheint und jedes mal, wenn der Mensch so tut, als hätte er es verstanden, hin und her springt und tänzelt, zeigt Setz selbst um was dieses Buch geht.
Das heißt, innerhalb dieser Grenzen, dieser Widerstände, die den Versuch, verstanden zu werden oder verstehen zu wollen, erst bilden, bewegt er sich. Er schreibt im und aus dem Limes der Sprache und umkreist das, was in uns ausgelöst wird, wenn wir in Berührung mit ebendiesen Limes treten, sei es ein Tänzeln, also in der Freude, sich verstanden zu fühlen, oder ein Winseln, eine Klage, ein Gefühl, alleine zu sein, alleine zu sprechen, von keinem Antlitz tatsächlich beachtet zu werden. Und in der gleichen Weise, wie diese Lust am Sprachspiel sich erst in der Berührung zur Unmöglichkeit „alles zu sagen“ entfacht, begegnet man in diesem Buch, Gott sei Dank, keine absoluten Antworten.
Man findet immer mehr Fragen, die die Lust am weiterlesen zünden, und die, paradoxerweise, zugleich schon auf alles eine stille Antwort geben zu scheinen — das aber eher als ein Zeigen denn als ein Erklären. Clemens reitet also spielsüchtig auf ein Fragezeichen, entweicht den Antworten, jeder Schatten den er wirft ist eine neue W-Frage, somit auch die Möglichkeit einer neuen Suche.
Und wie legere diese doch so gewichtige, transzendentale und oftmals schmerzhafte Suche geschrieben und beschrieben ist. Es ist ein anderer, sehr wichtiger Punkt: wie unkompliziert und wie sachte hier Beispiele und Anekdoten herbeigeführt werden, wie locker, nüchtern und geerdet eigene Erfahrungen und Lebensberichte beschrieben werden, alles Aufzeichnungen, die nie die alles unterstreichende Thematik von Verstand und Sprache, Frust und Spaß verlassen, diese aber auch nicht vereinfachen oder verkomplizieren.
Ohne Angst vor Leere und ohne der oftmals damit einhergehenden Reaktion, ebendiese Angst mit dem Schein des Komplexen zu schmucken und mit Ornamenten zu stopfen, nähert er sich dem Gegenstand wie ein lässiger Spaziergänger der nebenbei redet und redet, dahinwandert ohne Zentrum, lässt dabei den Gegenstand, nahe Felder, ähnliche Fragestellungen, auf dieser Weise und beinahe peripher von selbst in Erscheinung treten. Man könnte sagen, die Geschichten sprechen aus sich selbst, auch wenn das erstmal redundant wirken mag, aber sie benötigen keine allzu ausgeklügelte Verzierung (wie sie in dieser Kritik stattfindet); ihre Komplexität liegt in der Einfachheit und in der Umrahmung, in der raffinierten Formulierung und Ausführung des Autors, der die Schlichtheit meistert.
Es sind tatsächlich wahre Geschichten, ein bisschen gewürzt, mit Humor versüßt, die hier erzählt werden, sie haben aber sofort etwas museales; man sieht sie sich an, wird zugleich von ihnen angesehen; auf ihre Tragik, auf ihre Freude, auf ihre Rarität und Nihilität muss nicht hingewiesen werden, denn sie weisen diese auf uns. Also, was ist dieses Buch? Ein … ein erzählendes Sachbuch? Lieber will man es nicht festhalten und einzäunen. Der Inhalt könnte genauso gut vom Kopf eines magischen Realisten stammen, auch aus einem Roman Oliver Sacks’ entnommen worden sein, um aus dem Einzelnen ins Große zu zielen, oder nichts von beiden; er könnte auch nur eine sinnlose Maschine ohne Nutz und Zweck sein, eine Rude Goldberg Maschine der Sprache, nur da um da zu sein, wahr oder falsch, egal, banal und banal und banal und deswegen essenziell.
Egal ob echt oder falsch: alles ist echt und alles ist falsch. Egal wo, immer Frage, immer Trieb, der Instinkt, die Vermittlung, der Körper, Vehikel seltsamer Semantik. Die Öffnung neuer Räume durch (Ver-)Fremdsprachen, die innige Beziehung zwischen Körper und Wort, die Übersetzung von Körper auf Welt und Welt auf Körper, die enorme Vielfältigkeit der sprachspielenden Lyrik, alles wird dort aus Beispielen heraus und in Beispielen hinein, mit viel Wissen, vielen Quellen und vielen beinahe mythologischen Kuriositäten einfach so nebenbei erzählt.
Nennen wir dieses Buch mal: eine Sammlung karnevalistischer Menschheits- und Sprachanekdoten; so reitet Clemens J. Setz nicht nur auf Fragezeichen, er surft auch im Internet und reitet auf Cambria-Wellen, Buchstaben, die in Sprachwelten und Sprachräumen gehaftet sind, die man nur im Nicht-Erreichen erreichen kann — und unter ihm ein zischendes Surfbrett aus Sprachlosigkeit, Sprachfindung, Verständigung, Befreiung und Nonsense.
Erinnern wir uns an Lichtenbergs Einsicht: “Es ist nicht zu leugnen, dass das Wort Nonsense, wenn es mit gehöriger Nase und Stimme ausgesprochen wird, etwas hat, das selbst den Wörtern Chaos und Ewigkeit wenig oder nichts nachgibt. Man fühlt eine Erschütterung die wo mich meine Empfindung nicht betrügt von einer fuga vacui des menschlichen Verstandes herrührt”.
Die “fuga vacui”, die Flucht vor der Leere — aber welche Leere is es hier eigentlich, die uns so anpacken und erschüttern kann?
Jetzt etwas persönlicher. Ich möchte all die, die sich dem Nichts widmen, umarmen und sagen: das ad Absurdum, ja, ja, das ad Absurdum noch weiter übernihilisieren, überstrapazieren, das Volle umstürzen im vollem Übersturz! All die, die das Banale aufnehmen, möchte ich begrüßen. Es hat etwas heldenhaftes, wenn Ritter gegen ihre Rüstung antreten. Und wenn Don Quixote zum Schluss wieder gesund wird, da spürt man Don Quixote schon sterben. Dort, wo man nichts sagen kann, wird viel gesagt, und jedesmal, wenn etwas nicht gesagt werden kann, wird ein neues Sagen erfunden.
Es strömt mehr Inhalt aus der beengenden Leere eines Raumes mit viel Hall, als aus dem tausendmal aus Kopfhörern gehörten und überhörten Ich-Singe Gesang über ich und du und die Welt geht unter und wir merken nichts davon. Lieber tausendmal Bla lesen als tausend mal Bla verstehen müssen. Umso erfreulicher also, als das Buch anfängt eben das aufzugreifen, das die Leere selbst aufgreift, sich so zu sagen Raum gibt, um über Nonsens zu sprechen.
Eine neue unmenschlich menschliche und tragikomische Erzählung öffnet sich für den/die Lesende/n. Setz redet da, übersetzt Übersetzungen von Hindernis auf Wort, da ein irrwitziges Menschentheater, da eine Vermengung von Banalität und Tiefgründigkeit, da spielende Tiere, da ein ernstes Podium und viel Husten. Die Bühne: nicht die Sprache sondern die Unmöglichkeit, der Impuls, der Wunsch, Sprache zu finden, sich neu zu (er)finden, sich von Sprache und durch Un-Sprache loszulösen. Aber das habe ich nun auch schon zu oft gesagt. Aber das habe ich nun auch schon zu oft gesagt. Aber das habe ich nun auch schon zu oft gesagt. Aber das habe ich nun auch schon zu oft gesagt. Rastlose, kindliche Neugier. Rastloses und Kindliches.
Alles in allem, was ich noch sagen wollte, was hier noch gesagt werden sollte, was ich hier meine, was diese Rezension über dich erzählt, was dieses Buch über Handke’s secret home family verrät, was hier banal sein sollte, hier ein figurenreiches Buch, ein Buch mit viel Wissen, das nichts weiß, und was sie wissen sollten, was man nicht vergessen will, was man weiß, Lebenswege, Plansprachen, Grammatik, was da ist, was nicht, was man will, was will man, eigene, autobiographische Details, Übersetzungen in Kunstsprachen, geschriebene, wunderbare Lyrik, Sprachspiele, Google-Übersetzer, Barack Obama, ein Lob dem sprachlichen Unsinn, Namen, Namen, Namen, Franz Kafka, Jacques Derrida, Dagmara Kraus, Paul Celan, H. C. Artmann, Felix L. Ernst, Oskar Pastior, Walter Benjamin, Rilke, und dennoch auch keine Namen, Namenlose, Namenlose, Namenlose, und vieles ist doch ganz nahe, sozusagen um die Ecke.
Die Bienen und das Unsichtbare von Clemens J. Setz ist im Suhrkamp Verlag erschienen.



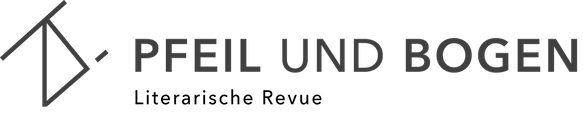











1 Kommentar
Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine fehlerhafte Ausgabe von Kafkas Erzählung besitze – aber in meiner Version von EINE KREUZUNG (Kafka, Die Erzählungen, Frankfurt 2007) findet diese Interaktion zwischen Besitzer und Kreuzung gar nicht statt. Das Tänzeln auch nicht. Es wäre sicherlich lohnenswert diesen Aspekt in einer Interpretation/Kritik zu berücksichtigen. Zumal es eines der zentralen Bezugssysteme des Buches von Setz ist. 😉