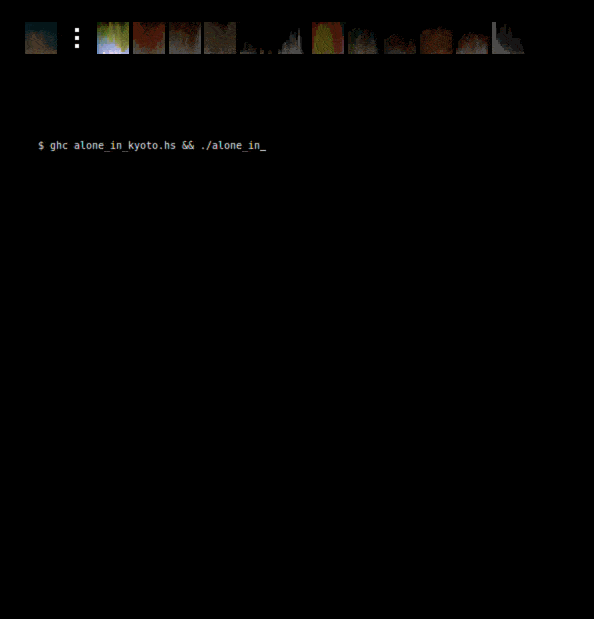Mit schöner Regelmäßigkeit wird im Feuilleton, auf der Buchmesse oder auf Literaturwissenschafts-Podien gefragt: „Wie verändert das Internet die Literatur?“ Viel interessanter als die betrieblichen Diskussionen rund ums Ebook, Copyright und Amazon ist dabei natürlich die Frage, wie sich „das Digitale“ in der literarischen Ästhetik niederschlägt. Da waren die Hypertext-Experimente in den 90ern, in den späten Nuller Jahren wurde dauernd der große Facebook-Roman gefordert, bei Jonathan Frantzen twittern die geschundenen Familienväter jetzt, und Jarett Kobek ist in I hate the Internet mit der Planierraupe einmal durch’s Silicon Valley gerast. Aber die interessanteste literarische Bewegung, die sich mit den gegenwärtigen Umwälzungen kritisch und innovativ auseinandersetzt, ist in Deutschland bisher kaum beachtet worden. Der von Hannes Bajohr herausgegebene Band Code und Konzept will das nun ändern.
Konzeptuelles Schreiben ist eine literarische Avantgarde-Bewegung, die Appropriation und Plagiat, De- und Rekontextualisierung oder Schreiben nach vorformulierten Regeln als Verfahren experimenteller literarischer Textproduktion nutzt. Das berühmteste Beispiel ist Kenneth Goldsmiths Day (2003), für das er eine gesamte Ausgabe der New York Times von vorne bis hinten abtippte und als 700-seitigen Roman, als Blocktext in Times New Roman, Schriftgröße 12, gesetzt, unter seinem eigenen Namen wiederveröffentlichte und sich damit ein Verfahren wegen Copyright-Verletzung einhandelte. Das er gewann. Solche konzeptuellen Texte sollen dabei natürlich nicht im klassischen Sinne „gelesen“ werden. In der Tradition der Conceptual Art der 1960er Jahre liegt der ästhetische Fokus auf dem Konzept:
So stellt das Conceptual Writing Fragen nach den Konzepten des literarischen Feldes, etwa nach dem Wesen des literarischen Kunstwerks, der Autorschaft, des Copyrights, der Originalität, des Mediums Buch, der Rezeption und Distribution von Werken, oder der Rolle von Institutionen. Damit positioniert sich das Conceptual Writing strategisch gegen vermeintlich überkommene Traditionen, die von den Protagonisten karikaturartig als „romantic subjectivism in contemporary poetry und psychological realism in prose writing“ verkürzt werden, und präsentiert sich selbst als avantgardistische Alternative – am Besten versinnbildlicht vielleicht im Selbstmarketing-Begriff des „Unkreativen Schreibens“, mit dem Goldsmith den ganzen Literaturbetrieb der USA in Unruhe versetzte.
„Nötig“ wird Konzeptuelles Schreiben, da das neue textuelle Ökosystem mit seiner nie zuvor da gewesenen Verfügbarkeit an kopierbarem und verlustfrei manipulierbarem Text eine Adaption der literarischen Epistemologie und Ästhetik erfordert. In den Experimenten konzeptueller Literatur im digitalen Zeitalter erweitert sich der Schreibbegriff und umfasst auch „techniques traditionally thought to be outside the scope of literature, including word processing, databasing, identity ciphering and intensive programming“.
Genau an dieser Stelle setzt Code und Konzept ein.
Bajohrs Band stellt die Frage, wie man Konzeptuelles Schreiben und digitale (also algorithmisch hergestellte) Literatur zusammendenken kann. Dabei ist Bajohrs These: Verbindet man Konzept und Code miteinander, erfolgt eben kein „De-Skilling“ der Autorinnen und Autoren, die nur noch copy-pasten, sondern im Gegenteil ein „Re-Skilling“ – nun aber im Bezug auf die Entwicklung von tragfähigen Konzepten und praktischen Fähigkeiten des Programmierens, um diese umzusetzen.
Der Band hat drei Teile: Theorie, Theorie & Praxis und Praxis. Die ersten beiden Teile versammeln neue Texte von deutschsprachigen Wissenschaftlern und Praktikern aus verschiedenen Disziplinen (Literaturwissenschaft, Netzkultur, Kunst) und englischsprachigen Autorinnen und Autoren, deren Texte hier zum ersten Mal in deutscher Übersetzung erscheinen — allein das eine große Leistung des Herausgebers. Dabei deckt „Code und Konzept“ die ganze Variationsbreite von akademischer Spezialdiskussion bis spielerisch-ironischen Essays ab.
Thomas Schulze montiert etwa in David-Shields-Manier Theoriesschnipsel und Clemens-Setz-Tweets und proklamiert damit eine „Kleptopoetik“, in der das gekonnte Auswählen, Samplen und Rekontextualisieren von gefundenem Text die neue Autorentätigkeit darstellt. Dabei macht Schulze ironisch auf die Differenz zwischen Netzkultur (Sample, Remix) und Buchkultur aufmerksam, denn alle Textbausteine sind mit Fußnote und exakter Quellenangabe versehen — versucht man „Kleptopoetik“ in den Kontext einer wissenschaftlichen Publikation zu übertragen, wird daraus durch die Konventionen der „good academic practice“ und den rechtlichen Vorgaben des Verlags eben wieder nur die altbekannte „Quotopoetik“.
Oder J.R. Carpenter, die den Quellcode eines „web-basierten Werks digitaler Belletristik“ abdruckt, die Funktionen des Codes erläutert, und ihn mit Kommentaren und Zitaten (Ong, Deleuze, Hayles) versieht — und damit eine neue wie erkenntnisreiche Textform schafft: „Um die Performance dieses Textes zu erörtern, so, wie er auf dem Bildschirm erscheint, ist es notwendig, den Quellcode, der diese Performance hervorbringt, ebenfalls zu diskutieren“ (S. 126).
Mit dabei ist auch Florian Cramer, der seine These vom „Postdigitalen Schreiben“ hier noch einmal erweitert, Daniel Scott Snelson mit einem fantastischem Text über Textwarez und subversive Distribution von Martin-Walser-Textfiles im Netz, oder Beat Suter und René Bauer, die das Verhältnis von Code und Konzept auseinandernehmen und dabei erklären, was Code, Programmiersprache, Algorithmus — Begriffe mit denen alltäglich undifferenziert hantiert wird — eigentlich bedeuten.
Nicht zu vergessen der unterhaltsame Rekursions-Essay von Anna Seipenbusch, die in (nicht-willkürlicher) Copy-Paste-Manier auf einen Text aus der BELLA triste #39 antwortet: “Q: How do I explain recursion to a 4-year-old? A: Explain it to someone a year younger than you & ask them to do the same. Expand.” (S. 151)
Wirklich begeisternd ist vor allem aber der letzte Teil des Bandes, Praxis, denn er löst nach aller Theoriehuberei spielend den Anspruch des Bandes ein, zu zeigen, wie Code und Konzept zusammenhängen — und endlich kann man ein paar dieser konzeptuellen-digital-born Texte konkret lesen.
In vorangestellten Texten schildern die Autorinnen und Autoren ihre Poetik. Sie erklären die Konzepte der Texte und beschreiben genau, welche Entscheidungen und (Programmier-)Schritte zur Herstellung nötig waren. Dabei zeigen die Autorinnen und Autoren ein derart hohes Maß an Selbstreflexion, das man sich auch von manchen Poetiken der Belletristik wünschen würde. Vor allem aber zeigen die Poetiken, dass Konzeptuelle Literatur eben nicht bloß Copy-und-Paste-Literatur ist, die man mal kurz zusammenknallt, sondern an den Avantgarden und der Moderne geschulte, sprachkritische Literatur, deren Produktion neben Programmierskills auch ein systematisches Verständnis des literarischen Feldes voraussetzt.
Allison Parish erläutert, wie sie ein Traum-Wörterbuch („10.000 Träume erklärt und gedeutet“) als Quelle für einen automatisch generierten Roman nutzt. Sehr detailliert analysiert sie, wie und warum sie die Traumdeutungen automatisiert in die Ich-Perspektive übersetzte, die Träume durch einen Algorithmus für Stimmungsanalyse nach negativ und positiv ordnete, und das Ganze noch mit einer Datenbank kurzschloss, welche die hinter den Träumen stehenden Konzepte erklärt.
„Wenn ich generativen Text erzeuge, möchte ich, dass meine Arbeit ausdrucksstark ist und Sinn evoziert, aber gleichzeitig auch, dass seine Form die Prozesse demonstriert, die ihn hervorgebracht haben. Darüber hinaus möchte ich meine generative Arbeit als kritische Lektüre – als einen Weg, verborgene Strukturelemente des verwendeten Quelltextes ans Licht zu bringen.“ (S. 216)
Bemerkenswert ist hier nicht nur die Hellsichtigkeit, mit der Parish ihre konzeptuellen Texte in die Nähe von Faktographien, also Texten, die den Prozess ihrer eigenen Herstellung demonstrieren, rückt, sondern vor allem die Erkenntnis, dass digitales konzeptuelles Schreiben gar nicht weit entfernt ist von den Verfahren, die derzeit in den Digital Humanities diskutiert und angewandt werden. Im Konzeptuellen Schreiben, so könnte man also sagen, nehmen die Digital Humanities einen „practice turn“, und werden dezidiert als künstlerische Forschung umgesetzt.
(Ob dieser großartige Text aber wirklich ein Roman ist, wie Parish behauptet, ist eine ganz andere Frage.)
Großartig auch Ranjit Bhatnagars Poetik zu seinem Bot „Pentametron“, der Twitter nach Nachrichten im Pentameter durchsucht und sie retweetet, und den daraus entstandenen Cut-up-Sonetten, oder Caitlin Quintero Weavers „Susan Scratched schreiben“, in dem wiederum der Code mit Kommentaren abgedruckt ist, und man dadurch wirklich mal zu verstehen scheint, welche Permutationen der Code wo und warum im Ursprungstext auslöst.
Oder Gregor Weichbrodts Überlegungen zu „I don’t know“, einem generativen Poem, in dem ein lyrisches Ich sich iterativ durch Wikipedia forstet, und immer behauptet, es habe von keinem dieser Themen eine Ahnung — „digitale Demenz“ quasi. In bester, selbstreflexiver Conceptual-Writing-Manier beginnt der Text so:
„I’m not well-versed in Literature. Sensibility — what is that? What in God’s name is An Afterword? I haven’t the faintest idea. And concerning Book design, I am fully ignorant. What is ›A Slipcase‹ sup- posed to mean again, and what the heck is Boriswood? The Canons of page construction — I don’t know what that is. I haven’t got a clue.“ (S. 238)
Nach 350 Seiten endet das (natürlich im Band nicht ganz abgedruckte) Poem mit einer großen Pointe:
“I’ve never heard of Postmodernism. What the hell is A Dystopia? I don’t know what people mean by “The Information Age”. Digitality – dunno. The Age of Interruption? How should I know? What is Information Overload? I don’t know.”
Überhaupt ist Gregor Weichbrodt mit seinem Textkollektiv 0x0a der produktivste Schreiber deutschsprachiger konzeptueller Literatur – und seine intelligenten und gleichzeitig extrem witzigen Bücher sollte man sich unbedingt einmal anschauen.[1]
Nach der Lektüre des Praxis-Teils wünscht man sich sofort eine ganze Anthologie solcher Poetiken und konzeptuellen Texte, weil hier schlagend und einleuchtend literarischer Text und seine komplexen Produktionsverfahren nebeneinander gestellt werden. (Am Besten gleich mit Github-Archiv der verwendeten Programmiercodes, damit diese dann runterladen kann und selbst permutierend eigene konzeptuelle Texte herstellen kann.)
Am Ende der Lektüre von „Code und Konzept“ stellt sich dann die Frage, was von der Differenz zwischen Konzeptueller und „digitaler“ Literatur überhaupt noch übrig ist — oder ob die Frage von Anfang an eine konstruierte war, um diese tollen Texte in einem Sammelband zusammenzubringen, der hoffentlich erst der Auftakt zu einer intensiveren Beschäftigung mit konzeptueller Literatur im deutschsprachigen Raum ist.
Wer jetzt befürchtet, dass Literatur bald zur noch von Computern geschrieben und gelesen wird, der sollte umso mehr anfangen, sich mit konzeptueller Literatur beschäftigen. Denn gerade diese verhandelt kritisch und performativ die Umwälzungen, die „das Digitale“ für die Literatur und das Schreiben bedeutet, viel mehr als es etwa „I hate the Internet“ tut, auch wenn Jarrett Kobeks Schlag gut gesessen hat. Als Einstieg am Besten dazu „Uncreative Writing“ von Kenneth Goldsmith lesen (ebenfalls von Bajohr übersetzt), „Code und Konzept“ ist dann die Aufbaulektüre.
Um wem das nicht reicht, dem sei noch ein Satz aus Ingo Niermanns Beitrag ans Herz gelegt: „Noch haben sich die Maschinen nicht ohne Menschen in der Welt behaupten müssen.“ (S. 201).
—
„Code und Konzept“, herausgegeben von Hannes Bajohr, ist 2016 im Frohmann Verlag erschienen.
„Uncreative Writing“ von Kenneth Goldsmith
erscheint im März 2017 bei Matthes & Seitz.