Der Begriff weiß’ wird in diesem Text nicht als Beschreibung einer Hautfarbe verwendet, sondern als Bezeichnung einer privilegierten Position in einem rassistischen System. Er wird deshalb mit ‘ gekennzeichnet. Der Text bildet einen Nachrichtenwechsel ab, der laufend aktualisiert wird. Diese ist die 2. Folge, die weiteren Folgen sind unten verlinkt.
Tobi,
ich möchte, dass du dich mit mir sicher fühlst. Aber ich kann dir diese Unsicherheit, die du beschreibst, nicht nehmen. Ich bin auch jedes Mal aufs Neue verunsichert, wenn ich Diskriminierung erlebe, selbst wenn nicht ich betroffen bin. Außerdem kenne ich diese Unsicherheit auch von mir selbst, wenn ich in gesellschaftlichen Machtbeziehungen auf der privilegierten Seite stehe.
Jede Situation betrifft andere Umstände und unterschiedliche Menschen. Ich merke, dass ich mich dann, manchmal bewusst und manchmal unbewusst, unterschiedlich verhalte. In der Praxis der Frauenärztin fühlte ich mich schwach und ohnmächtig. Deshalb habe ich nicht sofort so reagiert, wie ich es gerne gewollt hätte. Du weißt, ich scheue mich nicht davor, anderen Menschen zu widersprechen oder eine Diskussion zu beginnen. Ich scheue mich auch nicht davor, als erste den Mund aufzumachen, wenn mich etwas stört. Ich musste in meinem Leben lernen, mit Rassismus umzugehen und habe mich viel mit dem Thema befasst. Dennoch wäge ich jedes Mal erneut ab: Wie soll ich mich höher gestellten Personen gegenüber verhalten? Könnten meine Reaktionen Auswirkungen auf meinen Job oder meine Note haben? Was soll ich sagen, wenn sich Freund*innen oder Familienmitglieder rassistisch verhalten? Wie soll ich mit Menschen umgehen, von denen ich möchte, dass sie mich sympathisch finden? Wie mit Menschen, die mir sympathisch sind, deren Beziehung mir wichtig ist? Du kannst dir vorstellen, dass ich jedes Mal, wenn ich neue Menschen kennenlerne, vorsichtig bin und genau hinhöre. Manchmal überlege ich mir schon vorher, wie ich auf eine unangemessene Bemerkung reagieren würde.
Als ich bei der Frauenärztin war, kannte ich dich noch nicht gut genug und wusste nicht, wie du auf mein Erlebnis reagieren würdest. Ich bemerkte deine Unsicherheit und wollte unsere noch neue Beziehung schützen. Die Auseinandersetzung mit der Ärztin ging weiter, doch darüber haben wir nicht so ausführlich gesprochen.
Sie hatte mir ja gesagt, dass sie für Kritik offen sei, und deshalb rief ich sie ein paar Tage später an. Erst einmal redete ich: Es sei unangebracht, so oft meine Hautfarbe und meine Herkunft zu erwähnen. Für mich bedeute die Frage „Woher kommst Du“ übersetzt: „Du kommst nicht von hier, du gehörst nicht hierher“. Sie kennzeichne mich als „anders“. Meine Haut sei nicht „sonnengebräunt“. Meine Heimat sei nicht Sri Lanka und schon gar nicht Indien.
Die Schärfe ihrer Antwort hat mich überrascht. Ihr Verhalten habe nichts mit Rassismus zu tun. Sie habe auch viele andere ausländische Patientinnen und keine habe sich in all den Jahren beschwert. Sie fände so eine Hautfarbe ja auch schön. Sie wurde immer lauter. Sie dürfe auch ihre Gefühle äußern und außerdem könne sie gar keine Rassistin sein, denn sie sei mit einem Ausländer verheiratet. Schließlich schrie sie: „Aus ärztlich-psychologischer Sicht kann ich Ihnen sagen, Frau Berndt, das Sie ein Problem mit Ihrer Identität haben“. Ich wolle ja nur meine Aggressionen bei ihr abladen. Als ich darauf antworten wollte, legte sie auf.
Ich habe dir, lieber Tobi, das zwar erzählt, aber da ich deine Unsicherheit bemerkte und ich Angst hatte, dass du dich unwohl fühlen würdest, beließ ich es dabei. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich auch Angst davor, wie du dich verhalten würdest. Ich wollte nicht noch mehr verletzt werden. Deshalb rief ich meinen Vater an, um meine Wut, meinen Ärger, meine Gefühle auszudrücken. Ich wollte uns Zeit geben herauszufinden, wie wir mit solchen Erlebnissen umgehen können.
Gleichzeit ist mir deine Unsicherheit sehr sympathisch. Denn die Menschen, die auf mich mit Ablehnung, Aggressionen oder Angriff reagieren, wenn ich Rassismus anspreche, scheinen sich oft sehr sicher zu sein. Auch die weißen’ Männer, die unseren Austausch hier auf Pfeil und Bogen kommentieren, scheinen sich sehr sicher zu sein, wenn sie rassistisches Verhalten rechtfertigen. Aber sich in gesellschaftlichen Machtverhältnissen angemessen zu verhalten, ist für alle Beteiligten mit Unsicherheiten verbunden.
Ich erlebe immer wieder, dass meine Vorstellungen, wie ich in einer weißen’ Mehrheitsgesellschaft leben möchte, meinen Gefühlen widersprechen. Einerseits, sollst du dich mit mir wohl fühlen. Andererseits denke ich: Ich habe es unbequem, ich muss mich ständig verteidigen und werde persönlich angegriffen – wieso sollte das Thema Rassismus für Weiße’ bequem sein?
In Liebe,
A.
Arpi,
bevor du das erste Mal zu meiner Familie mitgekommen bist, waren wir beide unsicher. Wir haben uns jede*r für sich die gleichen Gedanken gemacht, das haben wir uns erst danach erzählt. Wir hatten Sorge, dass du als erstes nach deiner „Herkunft“ gefragt werden würdest und waren froh, dass es nicht so gekommen ist. Auch meine Familie, das habe ich später erfahren, hat sich gefragt, ob es in euren Gesprächen zu viel um Sri Lanka ging. Mittlerweile denke ich, wir hätten uns allen diese Unsicherheit bereits vorher nehmen können, in dem wir sie offensiv angesprochen hätten.
Du hast die Reaktionen angedeutet, die es auf unseren ersten Nachrichtenwechsel gab, und tatsächlich ist es ja auffällig, dass sich vor allem weiße’ Männer (jeden Alters) herausgefordert fühlten, unsere Argumentation im besten Fall kritisch nachzuvollziehen und sie im ärgerlichsten Fall zu leugnen und klein zu reden. So selbstgerecht ins Abseits gestellt wie deine ehemalige Frauenärztin hat sich allerdings niemand. In der Bewertung ihrer Reaktion auf deine Kritik waren sich alle einig, denen ich davon erzählt habe. Warum es über die Szene in der Praxis aber so viel Diskussionsbedarf gab, der Hinweis auf rassistisches Verhalten hier als unbegründet abgetan oder als Angriff verstanden wurde, das kann ich, als weißer’ Mann, zumindest nachvollziehen, wenn auch nicht rechtfertigen.
In vielen Kreisen, in denen ich mich bewege – Studium, Jobs, Freundeskreis, Familie – kommen People of Color und ihre Stimmen selten vor. Das bedeutet, es wird anders über Rassismus gesprochen, als wir beide das voraussetzen. Der Ton ist meist sarkastischer, wo es um äußere Vorfälle geht und emotionaler, wenn das eigene Verhalten betroffen ist. Meistens steht irgendeine Form von Relativierung am Gesprächsbeginn, die darauf hinausläuft, dass Menschen nun mal verschieden seien und Rassismus damit quasi natürlich. Häufig wird zum Beispiel eine Anekdote davon angebracht, dass man im Urlaub in ferneren Ländern oder auf einer hypothetischen Reise nach „Afrika“ auch schon einmal komisch angeguckt worden sei oder werden würde. Gleichzeitig wird dabei immer aus einer Position gesprochen, die ein Bekannter neulich auf den Punkt brachte: „Rassismus? Ich verfolge die Diskussionen darüber mit Interesse, aber ich habe immer das Gefühl, das betrifft mich nicht.“ Die Perspektive ändert sich, wenn der Diskurs an einer Person greifbar wird, zu der eine Beziehung besteht. Die Argumente bleiben dann zwar die gleichen, aber die Bereitschaft, sich auf eine Diskussion einzulassen und die eigene Position zu reflektieren, ist höher. Darum waren die Gespräche, die wir in den letzten Wochen in unser beider Umfeld geführt haben, zwar vorhersehbar und mühsam, doch, wie ich finde, ausnahmslos konstruktiv. Und gleichzeitig waren diejenigen, in denen du physisch anwesend warst, doch insgesamt respektvoller.
Die Reaktionen auf unsere Texte haben mich zum Nachdenken darüber gebracht, in welcher Form sich Rassismus sinnvoll diskutieren lässt. Einerseits müssen wir abstrahieren um Strukturen kritisieren zu können. Andererseits denke ich, Veränderungen in Denken und Handeln sind nur über emotionale Bezugnahme möglich. Dass Möglichkeiten und Bereitschaft dazu den Wenigsten gegeben sind, ist sicher ein Problem. Ich glaube, unsere Bewertung deiner Szene bei der Frauenärztin als Rassismus hat viele deshalb so herausgefordert, da ihr alltägliches Verhalten in Frage gestellt wurde, über das sie sich bisher noch keine Gedanken machen mussten. Ich glaube auch, man kann und muss Menschen daran messen, wie sie mit dem Hinweis auf Rassismus umgehen. Jemand kann sich rassistisch verhalten, aber ist damit nicht sofort auch ein*e Rassist*in.
Was meine Unsicherheit angeht, so habe ich mich in den Gesprächen, die wir mit anderen geführt haben, bereits besser gerüstet gefühlt als noch vor einem Jahr. Ich denke, vor allem, weil wir sie gemeinsam bestritten haben.
Ging es dir auch so?
In Liebe,
T.
Die Folgen dieser Serie:
- Re: Rassismus (13.3.18)
- Re: Re: Rassismus (diese Folge – 16.4.18)
- Re: Re: Re: Rassismus (10.6.19)



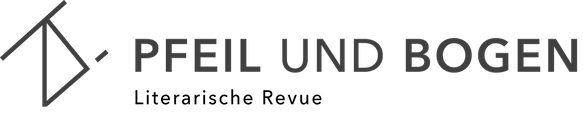










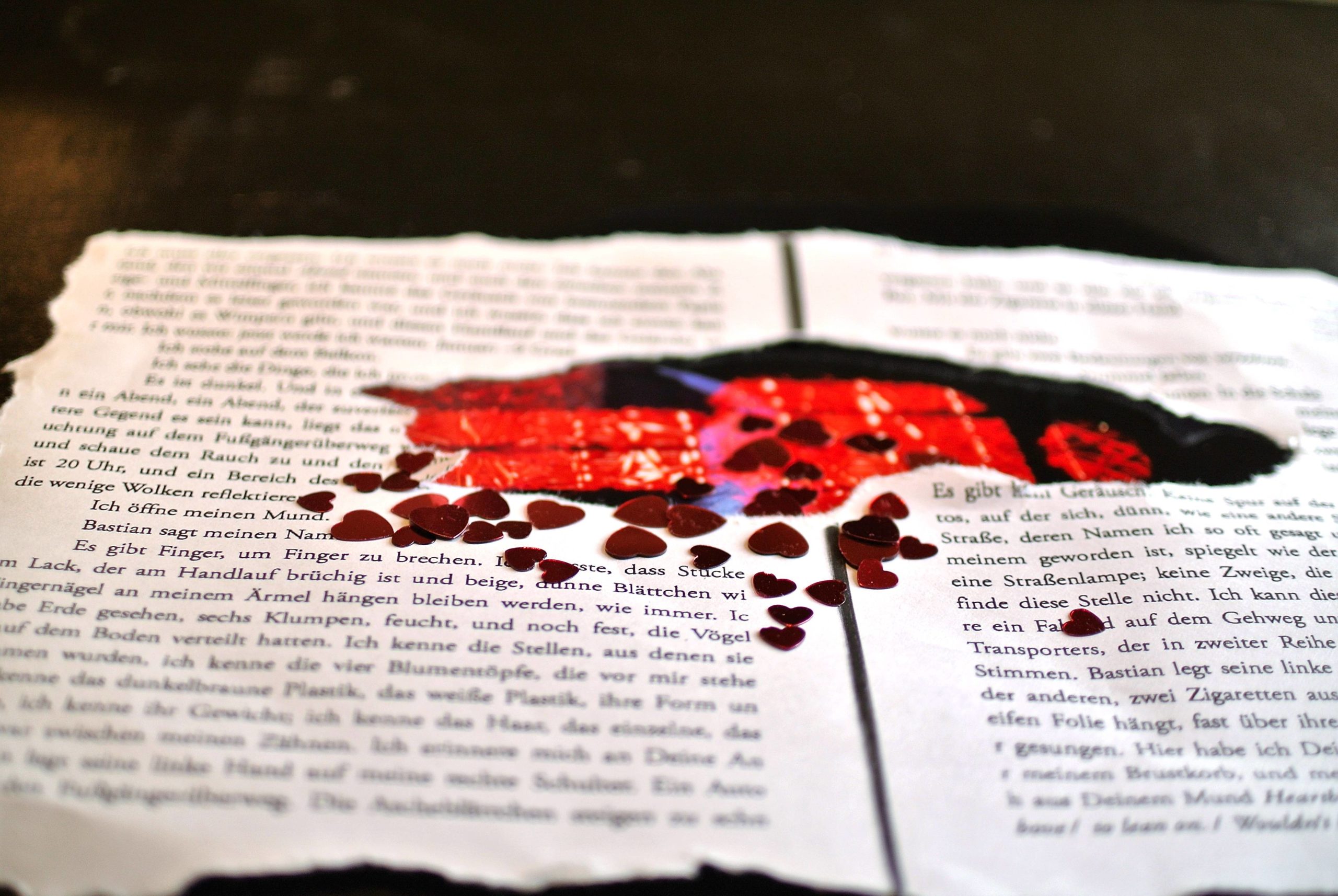
4 Kommentare
https://pfeil-undbogen.de/re-re-rassismus/
Lieber Tobias,
Du schreibst: “Jemand kann sich rassistisch verhalten, aber ist damit nicht sofort auch ein*e Rassist*in.”
-> Doch.
Ganz genau so ist es. Rassisten sind nicht erst dann Rassisten, wenn sie sich darüber bewusst sind Rassisten zu sein oder sich bewusst rassistisch Verhalten. Bewusstsein oder Intention haben nichts damit zu tun was Etabliert worden ist oder welche Wirkungen ein (unbewusstes) Verhalten nach sich ziehen. Egal ob ich die Absicht hatte jemanden zu verletzen oder nicht, so kann ich es doch jederzeit tun, auch ungewollt. Meine Absicht und mein Bewusstsein haben geringen Einfluss auf die Verletzungen meiner “Opfer”!
Meiner Erfahrung als B/PoC nach ist jeder Mensch, der in einer rassistischen Gesellschaft aufwächst erstmal zwangsläufig auch ein Rassist. Auch ich habe alle sexistischen und rassistischen Inhalte der Gesellschaft als Kind ungefiltert aufgenommen. Die vielen sexistischen und rassistischen Inhalte hatten natürlich Wirkung auf mich und ich lernte es, selbst Sexismus und Rassismus zu Leben.
Wie denn auch nicht? Wie sollte denn z.B. ein Kind erkennen können, welche tieferliegende Bedeutungen schon sehr viele “normale” Wörter in der deutschen Sprache haben oder dass viele dieser rassistischen und sexistischen Begriffe und Redewendungen ganz klar die Absicht Verfolgen Menschen mit diesen -Ismen zu “Impfen” und dadurch (den meisten Individuen unbewusst) ein Klima zu Erschaffen, welches Schwarze/PoC, Frauen, LGBTQi*, “Schwache”, Kinder, Alte, zu Dicke, zu Dünne, physisch oder psychisch Eingeschränkte, u.s.w.u.s.f. .. in ihre Schranken verweisen und gleichzeitig die Privilegien der weißen, hetero, CIS, able, (..) Männer(!) zu Zementieren!
Ich habe dies alles inhaliert, mit der Muttermilch aufgesogen, assimiliert, internalisiert und so weiter.
Also wurde ich zu einem Sexisten, Rassisten, etc aufgezogen – Du etwa nicht? Ich staune. 😉
Auch wenn meine Eltern viele der Inhalte selbst hinterfragt und mir aufgezeigt haben, wurde ich doch in fast allen Büchern, Filmen, Presse, Schule, Uni, etc schön auf die gesellschaftlichen Sexismen und Rassismen eingestimmt. Du nicht? Bist Du etwa in einem – mir unbekannten – nicht-sexistischen und nicht-rassistischen Deutschland aufgewachsen?
Bitte erzähl mir nicht, Du kämst aus einer progressiven, grünen, intellektuellen, aufgeklärten, gebildeten etc Familie. Solche sind es, meiner Erfahrung nach, die meist am heftigsten ihren angeblichen “Non-Rassismus” verteidigen, oft behaupten sie seien “Farbenblind”, jedoch sich nie wirklich Gedanken darüber gemacht haben, dass Rassismus ein strukturelles und gesellschaftliches Problem ist – kein individuelles! Jedoch bildet sich die Gesellschaft aus Einelpersonen und damit ist auch jede Einzelperson, die nicht aktiv Anti-Rassistisch vorgeht, automatisch ein weiteres Rad in der Funktion des rassistischen Getriebes und damit auch Rassist!
Die so oft propagierte “Farbenblindheit” der weißen hat die Funktion, die Folgen der Erfahrungen und Emotionen von PoC zu Negieren und unsichtbar zu machen – es dadurch zu einem alleinigen Problem der Betroffenen werden zu lassen, denn diese weißen könnten doch gar nicht rassistisch sein, sehen sie doch angeblich gar keine Hautfarben! Die Lebensrealitäten von B/PoC werden dadurch in den Augen der weißen beseitigt und das ist dann nicht mehr deren Problem.
Eine Schwarze Schwarze Freundin zu haben, macht einen weißen Mann auch noch lange nicht zu Anti-Rassisten. Im Gegenteil: dazu kommt auch noch das Machtgefälle durch Sexismus, welcher auch überall mit hineinspielt!
Rassist ist man nicht erst, wenn man Menschen rassistisch unterdrückt, angreift, lyncht etc. Mal ganz davon abgesehen, dass es eine lange Tradition bei weißen Sklavenhaltern ist (kein Fehler, Sklaverei ist nicht weg – Rassismus schon gar nicht) sich Schwarze Sextoys zu halten – das tun weiße Mäner genauso wie weiße Frauen.
Zurück zu mir und allen, die im rassistischen Deutschland (gibt es denn ein anderes?) aufgewachsen sind: Es kostet extreme Anstrengungen nach dem Aufwachsen all die “subtilen”, “unverfänglichen”, “harmlosen”, “gutgemeinten”, “traditionellen”, “normalen”, etc. Sexismen, Rassismen u.s.w. aus dem eigenen Denken, Fühlen und Verhalten zu beseitigen. Das ist ein extrem langwieriger und schmerzhafter Prozess. So wie immer, wenn man an sich selbst arbeitet und sich verändern will. Bei diesen Themen jedoch geht es an den Kern dessen, was wir für unser deutschsein halten: Sprache und Verhalten z.B.
Und immer wieder haben B/PoC und Frauen die “Unverschämtheit” weißen und besonders weißen Männern zusagen sie seien sexistisch und rassistisch – dagegen muss “Mann” sich doch wehren, oder?
NEIN! Hört doch bitte erstmal zu und versucht zu Verstehen. Hört doch erstmal auf zu Glauben ihr seiet doch erhaben vom Sexismus und Rassismus. Frauen glauben oft, dass sie den Sexismus nicht internalisiert hätten, geben ihren Sexismus aber unbewusst an ihre Kinder weiter. Genauso beim Rassismus.
Noch eins: Sexismus und Rassismus benötigen die Macht des Systems hinter sich um funktionieren zu können. Besonders an die weißen Männer: Nein, Ihr habt keinen “umgekehrten” Rassismus z.B. in Eurem Urlaub in einem Schwarzen Land erlebt, denn selbst die Staatsmacht in Schwarzen Ländern hat den weltweiten Rassismus internalisiert und gewährt weißen Privilegien und weißen Touristen erst recht. Wenn die Schwarze Person, welche Euch angreift, die Polizei ruft, wird trotzdem diese zur Ordnung gerufen und die weißen normalerweise beschützt. Wenn weiße in einem weißen Land eine Schwarze Person angreifen, und dann die Schwarze(!) angegriffene Person die Polizei ruft, läuft es fast immer gleich ab (mehrfach selbst erlebt): die um Hilfe bittende Schwarze Person wird rau behandelt und in Gewahrsam genommen, in manchen Fällen wird si von der Polizei verletzt oder verliert sogar ihr Leben – egal ob sie das Opfer in dem Konflikt war oder nicht. Schwarz in Deutschland zu sein bedeutet immer und überall unter Generalverdacht zu stehen und das Ziel von Rassisten zu sein – nein, nicht die mit den Baseball Schlägern und Hakenkreuzen, sondern ganz normale “Bürger”. Schon die scheinbar so “harmlose” Nachfrage “Wo kommst du denn *wirklich* her” entschleiert Rassisten!
Was weiße erlebt haben mag Diskriminierung gewesen sein und es kann auch daran gelegen haben, dass ihr dort Ausländer seid – nicht aber Rassismus. Tatsächlich gehen die B/PoC “Angreifer” danach nach Hause und schmieren sich vielleicht mit “Fair and Lovely” Bleaching Creme ein, um weißer zu werden – internalisierter Rassismus. Rassismus und Colorismus ist einfach mal überall. 🙁
Also IMHO: Rassist zu sein, ergibt sich schon durch die Gesellschaft – ohne eigenes Zutun oder Absicht.
Anti-Rassist zu werden, ergibt sich durch harte Arbeit an einem selbst – mit klarer, bewusster Absicht!
Zu sagen: “Jemand kann sich rassistisch verhalten, aber ist damit nicht sofort auch ein*e Rassist*in.” sehe ich als einen Versuch rassistisches Verhalten als doch gar nicht so schlimm darzustellen! Es gäbe doch schlimmeres und überhaupt: “sich rassistisch verhaltende Menschen sind keine Rassisten.”
Na WTF denn sonst?
Höre B/PoC einfach mal zu und versuche deren Erfahrungen ernst zu nehmen. Tue niemals etwas das die Erfahrungen von B/PoC in Frage stellt, nur weil DU sowas noch nie erlebt haben solltest.
One WoC: “Hey, this thing happened to me!”
One white male: “It’s never happened to me, I don’t thing it happens.”
WoC: “I’m telling you it does!”
Many PoC unisono: “It’s happend to me too!”
One white male: “It’s never happened to me, I don’t thing it happens.”
😮
Liebe Aparna,
sehr schön zu sehen, dass es noch mehr Deutsch-SriLankans gibt, die sich aktiv am Anti-Rassismus beteiligen! Vielen Dank und ich hoffe noch viel aus Deiner Feder Lesen zu können 🙂
Zu schade, dass Ihr die LeserBriefe nicht veröffentlicht!?
Hey DanAla,
danke für deine Kommentare! Es tut mir Leid, dass du dich in der Situation gefühlt hast Erklärungsarbeit in den Kommentaren zu leisten, das sollte so nicht sein. Ich stimme dir in vielen Punkten zu.
Da dies ein gemeinsames literarisches Projekt von Tobi und mir ist, lektoriere ich auch seine Briefe. Als Antirassismustrainerin unterscheide ich genau wie Tobi zwischen “Rassistsein” und “rassistisch handeln”, um genau die Differenz zwischen bewusstem und unbewusstem Handeln hervorzuheben. Grade in der Antirassismusarbeit ist nämlich unbewusstes rassistisches Handeln, das wir alle verinnerlicht haben, etwas über das wir sprechen können, woran wir arbeiten können und eventuell auch überwinden können. (Während ich mit bewusst rassistisch handelnden Menschen gar nicht ins Gespräch kommen möchte).
Dieser Briefwechsel ist ein Versuch unser beider Auseinandersetzung mit den Machtstrukturen, die unsere Beziehung beeinflussen, öffentlich zu machen und stellt hoffentlich nicht Diskriminierungserfahrungen in Frage.
Herzlich
Arpana
Liebe Arpi, lieber Tobi,
sehr geehrte Herren und Damen,
die Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus ist ganz offensichtlich ziemlich schwierig und – das versteht sich von selbst – stark emotional geprägt. Beim Lesen Eures Briefwechsels geht einem schnell auf, dass auch die Intellektualisierung des Problems nur bedingt hilft, da sie Definitionen und Nomenklaturen gebiert oder voraussetzt, die nicht von allen Gesprächsteilnehmer*innen geteilt werden. Vielmehr lädt das Wort dazu ein, sich daran festzubeißen, es auf die Goldwaage zu legen, zumal das geschriebene. Die Goldwaage bringt der Rassismus selbst schon mit und ums Intellektualisieren kommt man beim Reden über komplizierte Sachverhalte leider nicht herum, ich zumindest nicht.
Mir scheint es wie DanAla so, als hättet Ihr die anderen Kommentare, von denen Tobi sprach, nicht veröffentlicht. Vielleicht habe ich sie aber auch einfach nicht gefunden oder sie wurden inzwischen gelöscht. Ihr werdet Eure Gründe dafür gehabt haben. Doch auch in dem Wenigen, was an substanzieller Auseinandersetzung in den Kommentaren zu finden ist, lässt sich eines schon sehr gut erkennen: Die Neigung, einen moralischen Alleindeutungsanspruch zu erheben. Das ist zumindest fragwürdig, ist die Sache doch vielschichtig.
Während es Arpi, die hier immerhin ein Blog veröffentlicht, das wohl hauptsächlich von Weißen’ gelesen wird, die Gefühle Weißer’ zu Rassismus „egal“ sind, und sie es nicht als ihre Aufgabe sieht, ihnen denselben zu erklären, ruft DanAla gerade dazu auf, Schwarzen und Persons of Color einfach mal zuzuhören. Und Chris pflichtet dem sich unflätig aufplusternden Dein Vater bei, obwohl die beiden – man kann es nur vermuten – sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Rassismus gemacht haben müssten. Wenn ich Euch richtig verstehe, dürfte der eine die Haltung des anderen gar nicht nachempfinden können, weil der Kommentator Dein Vater weiß’ ist (letzteres ist freilich nur eine Vermutung).
Ein Stückweit möchte ich mich Chris anschließen: Identitätsdenken, der große Wunsch nach klarer Abgrenzung und die Beanspruchung der Reinen Lehre sind, gerade in der Linken Szene, weit verbreitet. Das erweist vielen Debatten, nicht zuletzt solchen im Bereich Diskriminierung, einen Bärendienst. Sie werden beendet, bevor sie überhaupt begonnen haben. Und das gerade in einer Zeit, in der die Rechte erstarkt und dabei die Zerfaserung der Linken clever zu nutzen scheint.
Dass es Grundsätze und Abgrenzung braucht, um für oder gegen etwas einzustehen, ist, denke ich, unumstritten. Es gibt auch Positionen, die man sich gar nicht erst anhören muss, da sich ihre Vertreter von vorneherein klar disqualifizieren, etwa durch gewalttätiges Auftreten, Gesetzesbruch oder einfach das deutliche Signal, dass sie in Wirklichkeit an einer Debatte kein Interesse haben sondern nur abladen wollen. Dennoch möchte ich die Frage nach dem Ziel einer Auseinandersetzung stellen? Was soll bei der Beschäftigung mit Rassismus herauskommen? Ab wann darf man jemandem seine Berechtigung absprechen, an einer Debatte teilzunehmen? Sind die Gründe für rassistisches Handeln eindimensional? Spielen Gründe überhaupt eine Rolle oder nur das Phänomen, also die Oberfläche? Und wäre nicht auch trotz emotionaler Vorbelastung ein Umgang mit diesem Phänomen möglich, der besagte Vielschichtigkeit und damit auch Ambivalenz zulässt?
Nehmen wir die Situation bei der Frauenärztin, die ich in Ermangelung eines besseren Wortes der Kategorie Alltagsrassismus zuordnen würde. Lasst uns Arpi, die Ärztin und Tobi als Figuren behandeln, denn das werden sie ja in der Nacherzählung für eine*n fremde*n Zuhörer*in zwangsläufig.
Nehmen wir an, alles hat sich so zugetragen, wie von Arpi berichtet. Ihre Erinnerung ist sicher nicht neutral, kann es nicht sein, doch sie ist das einzige, worauf wir uns hier stützen können. a) Ist die Frauenärztin eine Rassistin? b) Oder hat sie „lediglich“ rassistisch gehandelt? c) Und falls letzteres zutrifft, hat sie es absichtlich getan?
Lasst uns testweise annehmen: a) nein b) ja c) nein.
Es ist verständlich, dass Arpi die Frage nach ihrer Herkunft stört. Es ist ihr gutes Recht, unhöflich zu sein. Es verpflichtet sie auch niemand dazu, die Wahrheit zu sagen. Nur, was macht das mit ihrem Gegenüber? Besteht nicht die Möglichkeit, dass die Ärztin zugleich rassistisch gehandelt hat und einfach nur Smalltalk treiben wollte, wobei sie ganz oberflächlich nach dem Erstbesten griff, was ihr in die Finger kam – Arpis Haut? Lasst uns annehmen, dass es so war. Lasst uns darauf antworten: Aber das ist doch genau die Crux am Alltagsrassismus. Ein geschlossenes System, bei dem die Leute nicht einmal merken, dass sie drin stecken und es bedienen. Arpi hat sich angegriffen gefühlt, obwohl die Ärztin sie nicht angreifen wollte. Das lindert Arpis Schmach und die Verantwortung der Ärztin nicht.
Wenn ich die Wiedergabe der Arpi-Ärztin-Begegnung lese, denke ich zu allererst eins: Diese Ärztin ist hochgradig unprofessionell und, das plumpe Wort sei mir verziehen, auch ein bisschen doof. Eine Patientin, die Berndt mit Nachnamen heißt, zu fragen, wo sie herkommt? Indien und Sri Lanka in einen Topf zu werfen und anzunehmen, es gäbe „in der Region“ nur eine Sprache? Am deutlichsten zeigt sich der Nonsens beim Verweis auf die sonnengebräunte Haut. Um Silvio Berlusconi zu zitieren: „Obama è giovane, bello e anche abbronzato.“ Das ist selbstredend Schwachsinn. Ich gehe davon aus, dass der Ärtrin als studierte und approbierte Medizinerin die biologischen Gründe für Arpis dunkle Haut klar sind.
Doch halt, wo ich es gerade nachlese: Im Bericht über den Arztbesuch steht gar nichts von Sonnenbräunung. Die hat Arpi während ihrer Kritik an der Ärztin ins Spiel gebracht. Beim Arztbesuch ging es um Vitamin-D-Mangel, zugegebenermaßen mit der unglücklichen Formulierung Arpis Haut „sei viel stärkere Sonne gewöhnt“. Ihr ahnt bestimmt, worauf ich hinaus will. Arpi scheint es nicht darum zu gehen, was die Ärztin meint, nämlich dass Menschen mit dunklem Hauttyp aus medizinischen Gründen empfohlen wird, sich im Frühjahr und Herbst länger als Menschen hellen Hauttyps der Sonne auszusetzen, um den Bedarf an Vitamin D zu decken. Im Winter wird die Einnahme eines Präparats empfohlen. Arpi geht es darum, wie das bei ihr ankam. Es geht darum, dass eine solche Äußerung auf einen Nährboden fällt, der durch unzählige Vorerfahrungen bereitet wurde. Sie fühlt sich gedemütigt und ohnmächtig. Wie Arpi selbst schreibt, ist sie jedesmal vorsichtig und hört genau hin, wenn sie neue Menschen kennenlernt. Sie wartet schon auf die unangemessene Bemerkung und überlegt sich im Vorfeld, wie sie darauf reagierten könnte. Das ist nachvollziehbar, aber wo führt es hin?
Ich komme zurück auf die oben gestellte Frage nach der Zielsetzung. Was ist das Ziel des Anrufs bei der Ärztin? Arpi beantwortet das selbst: Sie möchte sich besser fühlen. Auch hier müssen wir uns auf Arpis Rapport verlassen und gehen davon aus, dass sie ihre Kritik freundlich, aber bestimmt vorgetragen hat. Was geschieht mit der Ärztin? Die wird nach obigem Modell (also der Annahme, sie habe nicht wissentlich rassistisch gehandelt) völlig kalt erwischt. Nun fühlt SIE sich angegriffen, natürlich. Wer täte das nicht? Leider erholt sie sich von ihrem Schreck nicht. Sie hört sich nicht in Ruhe an, warum zuvor Arpi so ging. Sie hätte sagen können: „Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Dennoch tut es mir leid, dass Sie sich angegriffen gefühlt haben. Es war nicht meine Absicht, Sie zu beleidigen.“ Wäre das für Arpi okay gewesen? Doch das tut die Ärztin nicht. Sie reagiert erneut unprofessionell und schwadroniert etwas Komisches von Ausländern. Sie fühlt sich, wie Arpi zuvor, grundsätzlich (vor)verurteilt. Was ist gewonnen? Fühlt sich Arpi nach dem Telefonat besser, so wie sie es sich zuvor erhofft hat?
Hier verlassen wir unsere drei Figuren und kehren zurück in die komplexe Realität.
Wie DanAla sinngemäß schreibt: Weiße’ sind auch von Rassismus betroffen. Nur nicht als Opfer. Aber, und das würde DanAla vielleicht bejahen, sind sie deshalb gleich Täter? Ich möchte das zumindest in Frage stellen und erneut mit Pragmatismus argumentieren. Was hilft es, die Kulturgeschichte, die Gräueltaten, die Weiße’ in zahlreicher Form Schwarzen und Persons of Color angetan haben und tun als eine Art Erbsünde in die Zukunft zu projizieren, eine Schuld, die nicht mehr abzutragen ist? Gibt es, wie der Kommentator Chris Mandela zitiert, einen anderen Weg, aus dem Rassenkampf auszusteigen? Einen, der sich informiert darüber, was geschehen ist, es anerkennt, verurteilt und versucht, im Hier und Jetzt Respekt walten zu lassen, aber auf moralischen Totalitarismus verzichtet und sich diesem auch nicht aussetzen muss?
Auch wenn mein Kommentar jetzt schon ellenlang ist, möchte ich an dieser Stelle auf den in Eurem Briefwechsel so oft erwähnten Begriff der Sicherheit eingehen, denn er hat viel mit Totalitarismus zu tun. Einhundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, weder in einer liebevollen Paarbeziehung noch in der Gesellschaft. Vielleicht in einer Diktatur, aber auch da nur für die Diktierer. Ich meine damit, dass wir bei allem Einsatz für die gute Sache nicht vergessen sollten, dass wir eine Welt, in der sich nie jemand durch irgendjemanden angegriffen fühlt, nicht herstellen können. Und ich frage mich auch, ob diese Welt wirklich erstrebenswert ist, denn sie wäre ziemlich unfrei. Hier möchte ich mich erneut, ein Stückweit zumindest, Chris anschließen: nach der Verhältnismäßigkeit eines Vorfalls zu fragen, ist keine Schande. Nicht einer Meinung mit ihm bin ich bei der Einschätzung, dass allein die Tatsache, dass wir in Mitteleuropa mehrheitlich fantastisch leben, gleich den Schluss zulässt, Dinge wie Rassismus spielten hier keine Rolle. Nur: Rassismus ist ja nicht die einzige Form von Diskriminierung und Diskriminierung nicht das einzige systemische Problem. Zu jedem Problem gibt es unzählige Standpunkte und noch mehr zwischenmenschliche Verhaltensweisen.
Es gibt Menschen, die in Deutschland geboren sind, deren Eltern aber aus einem anderen Land stammen, und die mit Stolz sagen, sie seien Koreaner*innen, Mosambikaner*innen oder Spanier*innen, selbst wenn der Pass etwas Anderes behauptet. So identifizieren sie sich, das ist ihre Identität. Es gibt, Ihr wisst es, B/PoC, die selbst Rassisten sind. Es gibt auch B/PoC, die – obschon mit Sicherheit genauso dem Rassismus Weißer’ ausgesetzt wie Arpi und DanAla – weniger ein Problem mit ihrer Identität haben als diese. Und das nicht, weil sie noch nicht „aufgewacht“ sind. Auch das gibt es, PoC, die sich über andere PoC intellektuell erheben und sie aus der Debatte ausschließen, weil sie sich in ihren Augen der Diskussion nicht würdig erwiesen haben. Sprich: Ich backe mir meinen eigenen Gesprächspartner, dessen Haltung entweder zu 100 Prozent zu meiner passt oder so konträr zu ihr ist, dass die Debatte eher einem Sich-gegenseitig-vor-die-Füße-Kotzen gleicht denn einem Dialog. Das lässt sich hervorragend auf ganz viele Diskussionen übertragen, soziale, philosophische, politische.
Meiner Meinung nach sind Kompromisse, wenn sie dieser Tage auch gerne verschrien werden, nicht das größte Übel sondern die Voraussetzung für eine funktionstüchtige Gesellschaft. Vielschichtigkeit ist schwer zu ertragen. Es ist schwer zu akzeptieren, dass etwas so und zugleich anders sein kann. Es macht das Leben und vor allem das Reden darüber nicht einfacher. Doch es kann Zusammenhalt stiften, Toleranz, Akzeptanz, friedfertigere Kommunikation. So viel Schmalz muss sein.
In Liebe,
Philipp