Warum Roman Ehrlich den Roman der Stunde geschrieben hat
Die jüngere Geschichte der dystopischen Literatur ist noch nicht geschrieben, da erreicht die postzivilisatorische Vorstellungskraft schon die nächste Stufe. Längst ist die Faszination für den Untergang und die grauenvolle Zeit danach zu einem Standardmotiv der Erzählliteratur geworden, zuletzt etwa durchgespielt von Juan Guses Lärm und Wälder (2015) und Thomas von Steinaeckers Die Verteidigung des Paradieses (2016). Das Setting ist jeweils unübersehbar an Cormac McCarthys The Road aus dem Jahre 2006 angelehnt. Es geht um die letzten Überlebenden einer untergegangenen einst zivilisiert genannten Welt und um die Frage, was aus ihnen wird, was aus dem Menschen werden soll und ob es den Menschen im Sinne humanistischer Zuschreibungen überhaupt noch gibt. Es sind Geschichten, die mit allen historisch gewachsenen Mitteln des Erzählens ihre Handlung nach dem Ende aller Geschichten ansiedeln. Das Reizvolle an den postzivilisatorischen Narrativen besteht in einer perfekten negativen Ästhetik, deren Erscheinungsformen man auch als Neuauflage eines zyklisch wiederkehrenden Ästhetizismus deuten kann.
Die Qualität der Romane von Juan Guse und Thomas von Steinaecker besteht vor allem darin, dass sie das Grundmodell des dystopischen Daseins auf eigenwillige Art und Weise weiterentwickeln, indem sie es variieren. Demgegenüber erscheinen die Figuren in Roman Ehrlichs vor wenigen Wochen erschienenem Roman Die fürchterlichen Tage des schrecklichen Grauens bereits als von apokalyptischen Visionen gesättigte Nachhut von Untergangsfaszinierten. Diese Leute können sich nichts Besseres vorstellen, als am Entstehen des ultimativen Horrorfilms mitzuwirken. Mit der Verlagerung des Endzeitmodus auf seine mediale Projektion in einem herzustellenden Film schafft es Roman Ehrlich, die dystopische Mentalität auf den beunruhigenden Befindlichkeitsstatus seiner Vertreter zurückzubeziehen.
Dabei schlägt Ehrlichs Roman mit einem furiosen hypotaktischen Sprachgewitter in einen Realismus der Leere um, der die Hintergründe der Faszination für die postzivilisatorische Barbarei in krassen Beleuchtungsszenarien zum Vorschein bringt. Die ideologisch zu nennende Gefolgschaft des zusammengewürfelten Filmteams gegenüber einem besessenen und stockautoritären Projektinitiator wurzelt in der tiefen Ratlosigkeit jedes Einzelnen gegenüber seinem Leben und seinen Gefühlen. Das kommt in den Geschichten zum Ausdruck, die diese Leute wie bei einem langen Casting von Angstbesetzten auf der Bühne eines Ulmer Hinterzimmerlokals präsentieren. Stellvertretend für die ganze Gruppe von paranoiden Orientierungslosen steht der Ich-Erzähler, der einfach gar nichts mit sich und der Welt anzufangen weiß und der sich wünscht, im Film eine Rolle zu übernehmen, in der er langsam und qualvoll umgebracht wird.
Als man für die Dreharbeiten zu einem gemeinsamen Marsch von Ulm nach Berlin quer durch Deutschland ansetzt, ist wochenlang niemandem klar, was eigentlich gefilmt und woran tatsächlich gearbeitet wird. Wie einst Fabrizio del Dongo in Stendhals Kartause von Parma über die Fragmente des Schlachtfelds von Waterloo, irren die Filmschaffenden durch die Bruchstücke einer Welt, die Deutschland heißt, und begegnen dabei gelegentlich einem Kollegen mit einer Kamera und immer wieder einmal dem Anführer Christoph und seiner rätselhaften Begleiterin Katja. Der Glaube an Christoph als charismatischen Regisseur lässt die potenziellen Schauspieler und Mitarbeitenden lange Zeit treue und duldsame Gefolgsleuten eines Mannes bleiben, der als einziger vorgibt zu wissen, was gespielt wird und wohin der Weg führt. Was sich so vermittelt, geht über den Schock-Ästhetizismus dystopischer Charaktere und Topographien hinaus.
Roman Ehrlich erzählt vielmehr die Entstehung des Protofaschismus aus den mentalen Verfassungen desorientierter Subjekte, sofern man unter Protofaschismus die Zusammenrottung Einzelner zu einem Bund unter einer Führerfigur versteht. Das betrifft nicht in erster Linie die historisch-politische Bedeutung des Begriffs, sondern seine sozialpathologische Ursprungsszene. Die Ulmer Filmschaffenden sind von Bildern des Grauens und des Untergangs besetzt, ohne noch eine reflektierende Distanz zu diesem Bilderterror aufbauen zu können. Es ist die Angstlust am größtmöglichen Schrecken, an der nackten Gewalt und an der Vision vom rudimentären Dasein nach dem Untergang, die diese Gruppe zusammenhält. Noch mehr ist es das trotz aller Konflikte, Debatten und Zweifel blinde Vertrauen zu einer bis zum Abscheu autoritären Führerfigur, die bewusst fordernd und herablassend mit ihren Anhängern spielt.
Roman Ehrlich hat den Roman der Stunde geschrieben, ein Buch, bei dessen Lektüre deutlich wird, welche mentale Realität hinter den wabernden dystopischen Phantasien steht, die, ob als Fantasystoff oder als Endzeitvision, zuletzt starke Verbreitung gefunden haben. Ehrlich hat die Ästhetik der Postapokalypse auf die psychische Dysfunktion von Subjekten geführt, die sich den Untergang dessen, was sie hervorgebracht hat und was sie selbst repräsentieren, nicht nur vorstellen, sondern in einem davon handelnden Film selber mitspielen wollen. Sie wollen ihre sozialen Figuren in der Bilderwelt auflösen, der ihre Einbildungskraft vollkommen unterliegt. In ihrem Mitläufertum reflektiert sich das dystopische Narrativ als Verfallenheit an eine falsche Autorität und als finale Verirrung der Subjekte im Dickicht der Bildzitate, von denen sie belagert sind.



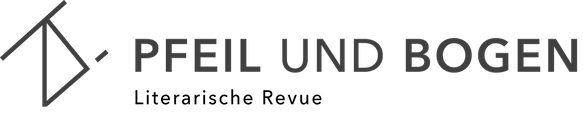


![Steve Jurvetson - [1], CC BY 2.0](https://pfeil-undbogen.de/wp-content/uploads/2017/04/Fiber_optics_testing-e1493370847178-560x420.jpg)







