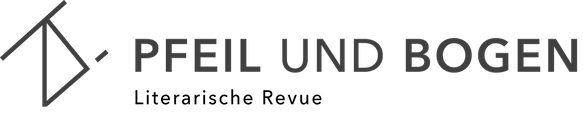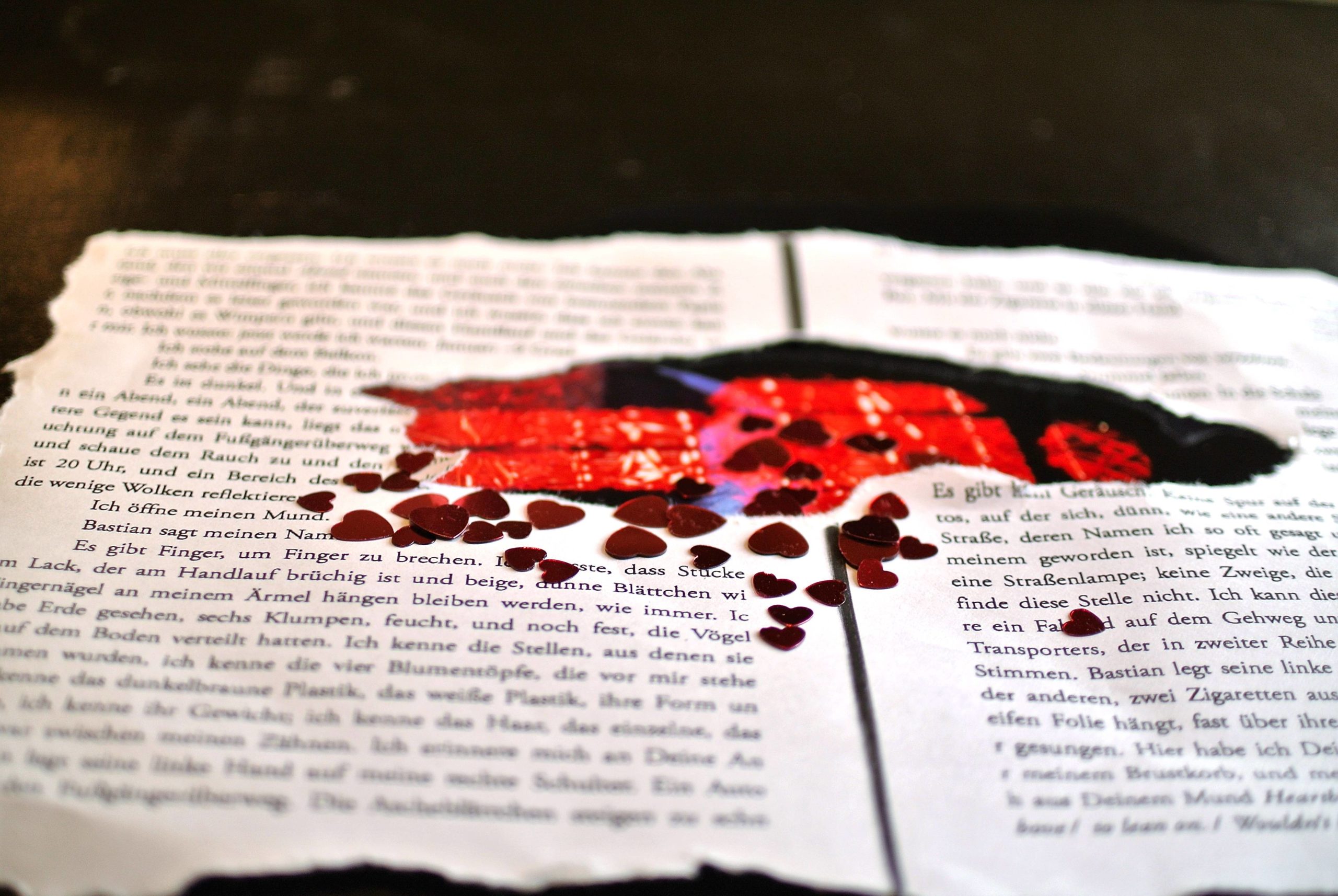„Durch eine Abgrenzung von anderen können wir einen Anspruch auf etwas erheben. Die Akzeptanz, dass wir nur Teil einer Sache sind und eigentlich gar nicht so anders wie unser Gegenüber, ist schwer für uns.“
Als ich Feride (29) Anfang August 2016 kennen lerne führt sie mich, im Rahmen meiner Gesundheits- und Krankenpfleger*innen-Ausbildung durch die Sehitlik-Moschee in Berlin-Neukölln. Mit Platz für 1.500 Gläubige ist die Sehitlik-Moschee nicht nur die größte Berlins, sondern vor allem eine, die um Öffnung und Integration bemüht ist. Das zeigt sich besonders in der Haltung des Vorstandes Ender Çetin – in seinen Bemühungen darum, Besuchergruppen wie uns durch die Moschee zu führen und in seiner Einladung zum Dialog mit Andersgläubigen und Atheist*innen. Wir sind 30 angehende Gesundheits- und Krankenpfleger*innen, die flüsternd im Kreis auf dem Boden des Versammlungsraums einer Moschee sitzen, um sich mit den Besonderheiten der Pflege muslimischer Patient*innen auseinanderzusetzen. Feride hat uns vor dem Betreten der Moschee darum gebeten, unsere Schuhe auszuziehen. Sie selbst trägt weite, lange Kleidung und hat sich einen Schal um die Schultern gelegt. Ihre schwarzen Haare fallen ihr weich über den Oberkörper. Über ihrem Kopf hat sie ein leichtes Tuch drapiert. Außerhalb der Moschee trägt sie kein Hijab. „Ich möchte auf Augenhöhe wahrgenommen werden“, erklärt sie.
Mit bedachter, klarer Stimme erzählt sie uns von ihrer Religion. Bereitwillig stellt und beantwortet sie alle religiösen Fragen, die bei ihr untrennbar mit persönlichen einhergehen. Später führt sie uns nach oben in den Gebetsraum. Die Sonne scheint warm und gedämpft durch die großen Glasfenster. Einige Gläubige beten auf dem dunkeltürkisenen Teppichboden. Durch die zahlreichen Fenster, die überwiegend strahlend weiße Wandfarbe und seine Höhe wirkt der Raum hell und weitläufig. Auf einem Dreiviertel der Raumhöhe ist er in ein zweites Stockwerk unterteilt, welches von einem marmornen Geländer eingerahmt wird. Von der weißen Kuppel des Daches, die am Rand von blauen Ornamenten umsäumt ist, unter denen sich sorgfältig verzierte kleine Glasfenster befinden, hängt aus einem dunkelgrün, hellblau und golden bemaltem Kreis ein mattgoldener Kronleuchter. Im vorderen Bereich des Raumes steht eine in Blau und Gold getünchte Kanzel, die von einem kleinen Turm überdacht ist.
Es ist ein warmer Spätaugusttag, als ich mich mit Feride zum Interview in einem Sushi-Restaurant in Berlin-Kreuzberg treffe. Wir setzen uns an einen Tisch, auf dem von Fußgängern belebten Bürgersteig und unterhalten uns ein bisschen. Feride hat Mittagspause und bestellt sich bei einem Kellner eine Sushi-Platte. Ich mir eine Kanne grünen Tee.
Seit sechs Jahren gibt Feride, die Wirtschaftsinformatik im Master an der Technischen Universität Berlin studiert, regelmäßig ehrenamtlich Führungen durch die Sehitlik-Moschee. Besonders der gegenseitige Austausch ist Feride ein wichtiges Anliegen, um sowohl ein interkulturelles als auch ein interreligiöses Verständnis zu fördern und Vorurteile gegenüber dem Islam abzubauen.
Dieser Austausch ist dringend nötig wie die 2014 durchgeführte Studie Deutschland postmigrantisch des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung zeigt. Von 8000 (über anderthalb Jahre) befragten Deutschen gaben 67 Prozent der Teilnehmer*innen an, dass sie ihr eigenes Wissen über den Themenkomplex Islam und Muslim*innen gering einschätzen.
Ferides Eltern, die in der Türkei aufwuchsen, lernten sich in Berlin kennen und bekamen zwei Töchter – Feride und ihre Schwester. Ihre Eltern waren und sind nicht praktizierend religiös. Doch durch Besuche in der Türkei erfuhren die beiden Schwestern immer wieder etwas vom gelebten Islam. Ob sie beteten und fasteten, war ihnen von den Eltern freigestellt. Ihr Vater, studierter Diplom-Geologe, der als selbstständiger Taxifahrer tätig ist, und ihre Mutter, gelernte Arzthelferin, arbeiteten viel. Deswegen wurden Feride und ihre jüngere Schwester vor allem von der Großmutter erzogen. Diese las den Kindern vor dem Schlafengehen kurze Suren vor, die Feride und ihre Schwester nachsprachen, bis sie sie auswendig konnten.
„In meiner Jugendzeit bin ich sehr gottvergessen herumgerannt. Ich hatte die Einstellung, dass man so und so sein oder aussehen muss, um bestimmte Dinge erreichen zu können, was sich bis heute tief in mir verankert hat.“
Für einen Moment schlägt Feride die langen Wimpern, die wie Fliegenbeine perfekt voneinander getrennt sind, nach unten, sodass ich den makellos aufgetragenen dünnen Lidstrich sehen kann, der ihre dunklen Augen umrahmt. Dann spricht sie weiter. „Ich habe mich relativ schnell darüber identifiziert zu sagen, ich sei Muslimin, ohne zu verstehen, was das überhaupt bedeutet. An was ich mich genau erinnern kann, ist, dass ich damals von einer Freundin, die den Islamunterricht in der Moschee besuchen wollte, gefragt wurde, ob ich sie begleiten wolle. Ich war davor noch nie in einer Moschee in Berlin gewesen.“ Während Feride erzählt, macht sie kurze Pausen, wie um sich bewusst zu machen, was sie da preisgibt. Ab und zu lacht sie leise über ihre damalige Unwissenheit.
„Was mich anfangs stark geprägt hat, waren die Menschen, die ich in der Moschee getroffen habe. Ich wurde mit meinem Wesen so angenommen, wie ich war. Ich realisierte, dass ich selbst oft hochmütig, stolz und herablassend gegenüber anderen gewesen war. Und dass mein bisheriges Verhalten nicht dem entsprach, wie es religiös empfohlen war. Sobald man das erkennt, muss man sich damit beschäftigen, mit sich selber. Das ist oft nicht einfach. Vor allem im Gebet muss man sich fragen: Warum bin ich eigentlich so, ist das so, mache ich das so? Je besser du dich selbst kennen lernst, desto näher kommst du deinem Schöpfer. Das ist meine Erfahrung.“

„Ich erkannte durch meine vermehrte Auseinandersetzung mit dem Islam, dass es einen Schöpfer gibt, der dich mit Liebe erschaffen hat und dass es einen Grund dafür gibt, dass du bist wie du bist. Das Bewusstsein dafür, dass ich nicht das Höchste aller Wesen bin und mich in die Schöpfung einordnen muss, hilft mir, mich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Dadurch relativieren sich die Herausforderungen, mit denen ich konfrontiert bin. Alles, was dir zustößt, sind Fragen von Allah an dich und es geht darum, wie du antwortest. Wie bin ich mit meinem Scheitern umgegangen? War ich dankbar oder undankbar, etwas lernen zu dürfen? Habe ich versucht zu verstehen oder bin ich daran verzweifelt?“