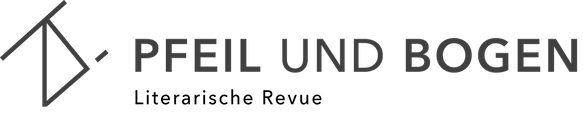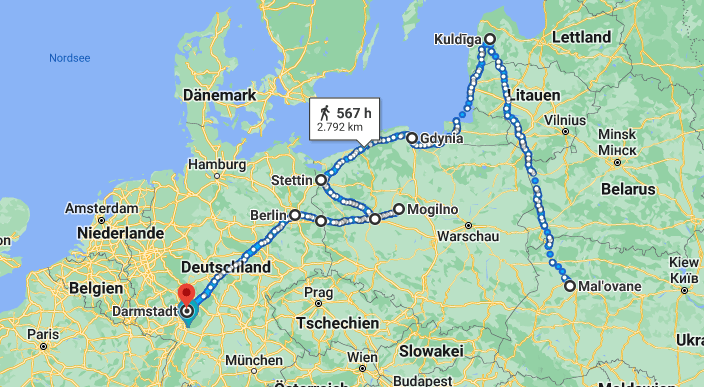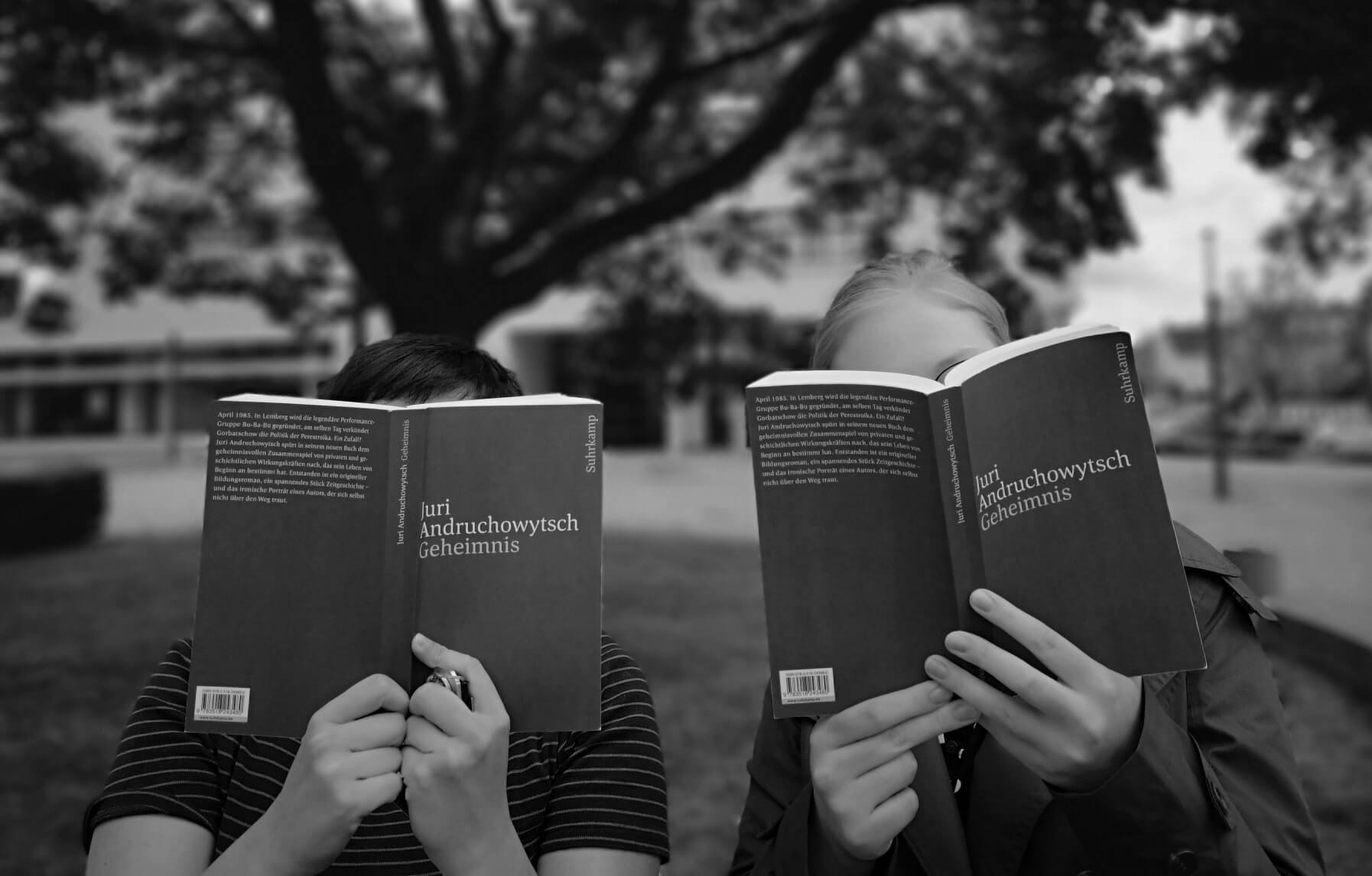Lies mich nicht, ich kehre ein, die Einsamkeit schließt sich endlich. Nichts muss verschieden sein und alles ist verschieden. Kein Vorhaben zerstört die Einsamkeit. Im Schreiben werde ich in sie entlassen, in das “Wagnis seiner lautlosen Leere” (Blanchot). Ich ruiniere alles und lasse doch alles bestehen. Es trifft nicht mich oder die, die mich nicht berühren. In dem ich verschont bin, beiseite gelassen, werde ich durch das, was außer mir ist, ein passiv Anderer. Ich werde nicht getroffen. Ich bin außer Reichweite, jede Grenze ist durchbrochen.
Wir stehen am Rand und sehen das, was nicht kommt. Es kommt nicht, steht nicht bevor, ist aber da, als das, was in der Ordnung der gelebten Zeit begriffen werden kann, was uns gehört und immer schon entzogen oder entraten ist in der Wörterflucht, in der ich weniger werde, viele Sprachen in meine hole, “das Unterdrückte in der Sprache dem Unterdrückenden in der Sprache entgegenstellen, die Orte der Nichtkultur, der sprachlichen Unterentwicklung finden, die Regionen der sprachlichen Dritten Welt, durch die eine Sprache entkommt, eine Verkettung sich schließt. … klein werden können, ein Klein-Werden schaffen” (Deleuze/Guattari). Gesang werden.
Sich dem Vernachlässigten zuwenden.
(Jan WiIm)
Ich kann nicht daran glauben, ganz gleich. Kein Glaube, keine Desinteresse, nur eine weiße schlaflose Nacht. Ein Kreis, dem der Mittelpunkt fehlt. Unentzifferbar bleiben, die Irre markiert, wenn der Zufall ein Sturz ist ohne Belang. Ein einfacher Verlust, dem nicht beizukommen ist und der das Nichts an die Stelle von allem rückt und der nichts groß schreibt und von nichts befreit. Eine Illusion von Satz, die nicht zulässt, dass man sich von ihr abwendet, dessen Dunkelheit durch Verstärkung abgemildert wird. Ein Satz aus der Theorie der Passivität.
Weniger werden
Du wirst immer weniger, sagt man mir. Jeden Tag weniger von dir. Ich nicke betroffen, als hörte ich das zum ersten Mal. Sonderbar, sage ich, dabei setze ich alles daran, nicht zu verschwinden. Wir lachen, und die Sorge der Beobachter verflüchtigt sich vorübergehend. Beim Essen legt man mir fette Bissen auf den Teller. Man wählt füllige Mäntel und Kleider aus, als könne man mich damit vermehren oder mein Volumen verdichten. Niemand scheint zu begreifen, dass meine Schmälerung ein langfristiges Vorhaben ist. Ich habe nicht vor, meine Entscheidung rückgängig zu machen.
Stunde um Stunde verstreicht, während ich immer weniger Raum einnehme. Ich muss nichts tun. An den Rändern bin ich bereits transparent. Die ersten Löcher klaffen in meinem dichten Gewebe. Ein luftiger Raum öffnet sich zwischen den Organen, der mich beinahe abheben lässt. Aber noch bin ich vor Ort. Ich hatte gehofft, diesen Weg nicht allein gehen zu müssen. Aber so, wie es aussieht, möchte niemand sonst seinen Platz aufgeben. Ich dagegen bin mit nichts zufrieden.
Das Zukünftige aus dem Werden herausbekommen, ist das Nächste. Das Zukünftige, das relativ Größere, das Dunklere oder Hellere, das Glattere, Weite, Spitze, Gültige oder Endliche, das Männliche und das Weiße, das Funktionale und Starke und Leistungsfähige, das Intensive, Gläubige oder Auserwählte. Statt dessen nur das Werden, das nicht ist oder bleibt, sondern sich in Bewegung befindet und nicht aufhört, immer weiter macht, das nicht mehr ist, sondern immer weniger, durchsichtig, brüchig, neben- und nicht übereinander, nicht selbst, nur anders, immer wieder, ohne Anfang und Ende.
“Werden ist nie imitieren” (Deleuze/Guattari). Ich werde weniger in mir und wenn ich schreibe, werde ich, aber ich werde kein Schriftsteller, sondern es ist ein “Ratte-Werden, ein Insekt-Werden, ein Wolf-Werden”, ein Vieles-Werden, Ansteckungen in immer neu bestimmte Gefüge.
faustregel, nahezu flucht: du bist nicht hier, um hauptsächlich heiler zu werden. und mein grüßen schlägt fehl, bin
Saskia Warzecha
ich noch nicht da. sozialisierung im suchumfeld. können nicht ablassen vom plan, das sterben zu lernen. fast-regel: erproben praxis, allein.
Warum ist das nicht da? Was geschrieben, gesagt, erwartet wurde. Ich bin ihm nie begegnet. Es wäre ein schöner Moment, als jede mit anderen sprechen könnte, unpersönlich, aufgenommen ohne eine Begründung. Aber warum ist es nicht da? Seine Anziehungskraft, den leeren Platz berücksichtigt, den es hätte besetzen sollen. Die Antwort stellt mich nicht zufrieden. Es sei ein wenig zurückhaltend; oder auch: es ist im weit weg. Vielleicht haben wir uns nur verfehlt. Sein schöner, manchmal bis zum Exzess verfolgter Stil.
Ich könnte ihn mir angeeignen, was dann dazu führen würde, dass ich mich dazu bestimmt glaubte, als müsste ich über die Sprache wachen. Der Stil brächte mich, durch seine Präzision, durch Eigenschaften, die scheinbar widersprüchlich sind, in Verlegenheit. Ich weiß nicht, ob dieser Stil nicht das Wissen ruinierte, dessen Eigenheiten mich dann gleichermaßen stören und begeistern würden. Mein Double nähme ich wahr, das, was ich gerne gewesen wäre.
Ich müsste mich fragen, warum ich mir an mindestens zwei Stellen vorwerfe, mich von der Vorstellung verführt haben zu lassen, dass es eine Tiefe gäbe, dass es sich um eine grundlegende Erfahrung handeln würde, die ihren Platz außerhalb der Geschichte habe und deren Zeuge ich doch sein könnte. Vielleicht war das ein nützlicher Irrtum, denn statt an mehrfach verborgene Bedeutungen zu glauben, könnte ich nun die Bedeutung selbst disqualifizieren, Signifikat und Signifikanten gleichermaßen.
Der Stil ist das Kleid, das ich mir nicht vom Leibe reißen kann. Wenn ich die Garderobe wechseln will, trenne ich versuchsweise die Nähe auf. Aber die Ränder sind zu verwachsen und eitern auch. Ich habe es versucht. Natürlich kann ich mir jederzeit etwas Luftiges überstreifen. Aber die Verkleidung sieht man mir an. Dachte ich jedenfalls bisher. Neulich trug ich ein besonders gesuchtes Stück, dessen Faltenwurf mich entzückte.
Darunter klebte das Hautkleid, aber das hat niemand bemerkt. Also geht es doch, dachte ich, ich kann posieren, wer hätte das gedacht. Einige Tage trug ich meinen Wortkörper durch die Gegend, gehüllt in feines Tuch. Dann irgendwann kam ich zu nahe an die Heizung, und wir verschmolzen zu einem Klumpen.
Der Geschmack des Wortkörpers, der Name und die Sache, die Empfindung und die Benennung schwimmen sich frei, nur da, wo sonst alles bewahrt und begraben ist, beruhigt und unversöhnt, verschwiegen und doch gesagt. Zwei Sprachen hat der Wortkörper, eine Zwiesprache, die sich und die Konventionen, in denen sie agiert, verschiebt, eine permanente Verwandlung von Arbiträrem in Motiviertes und zurück. Signifiant und Signifié tauschen die Rollen, sie können füreinander beides. Sie zeigen den Grund ihrer Möglichkeit.
Was ich hier schreibe, kommt nicht vor, sondern ist das, was für mich nicht mehr erreichbar ist, unberührbar und damit eine Möglichkeit, weil es das, was verborgen ist, nach außen stülpt. Alles darin ist auf diese Art schon berührt. Jeder Berührung geht voraus, was im Schreiben als unberührbar konzipiert wurde. Kein Innen, das nicht zugleich auch sein Außen wäre. Etwas zutiefst Oberflächliches, diese Poetik, kein Wort und kein Ding, sondern das, was im Schreiben wiederholbar wird, was wieder und wieder wiederholt wird, um den Raum des Einzigartigen, des Unwiederholbaren in Szene zu setzen, in dem Glück und Scham zusammenfallen.
Zwei Sprachen hat unser Schreiben, und darin zahllose Sprachen, wir tauschen die Rollen und machen uns möglich.
Wie unterscheiden zwischen dem eigenen Gesetz der Äußerung und ihrem Inhalt, wenn die Sprache etwas ähnlich macht (Adorno), das Sprechen aber fallen lässt. Ich kann das erfahren, es hören und sehen, fühlen, was der Sprache als dem, was gedacht und vorgestellt werden kann und vom Schreiben prozessiert wird, ähnlich ist. Die Ähnlichkeit ist ein Verhältnis, nicht die Folge. Konstellation nennt Adorno das, die nicht mehr auf Repräsentation und den mit ihr verknüpften Anspruch angewiesen ist.
aboutness of art
bouts of art
art of aboutness
Nichts muss mit sich selbst identisch sein, sondern “nur vermöge der Trennung von der empirischen Realität, die der Kunst gestattet, nach ihrem Bedürfnis das Verhältnis von Ganzem und Teilen zu modeln, wird das Kunstwerk zum Sein zweiter Potenz.” Literarisches Schreiben sorgt für Proben, modelliert mögliche Identitäten, um den Identitäts- und Repräsentationszwang der übrigen Welt aufzuheben oder aufzuschieben.