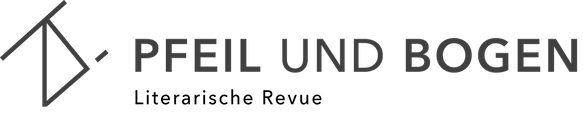Sie ist meine erste… Kundin? Das Wort Kundin gefällt mir nicht. Es passt auch nicht. Ich nehme ja gar kein Geld. Sie ist der erste Gast auf meinem Sessel, das passt besser. Den Sessel (ein großer Ohrensessel) habe ich allein zu diesem Zweck in diesen Raum gestellt. Er ist nicht allzu bequem, denn er muss hart genug sein, um aufrecht darauf sitzen und klar sprechen zu können, er ist aber trotzdem noch so weich, dass ein sehr kranker Mensch es so lang wie möglich darauf aushält.
Vor dem Sessel steht ein Tisch. Zwar ist das Mikrofon an einem Ständer befestigt, der auf dem Boden steht, der Tisch müsste also nicht unbedingt vor dem Sessel stehen, aber manche Menschen möchten vielleicht Notizen mitbringen, die sie dort ablegen könnten. Und außerdem habe ich mir gedacht, und das ist der wichtigere Grund für den Tisch, es könnte vielleicht guttun, nicht so ganz dem Raum ausgesetzt zu sein und sich ein wenig dahinter verstecken zu können.
Der Tisch ist ein bisschen niedriger als ein normaler Esstisch, weil der Sessel niedriger ist als ein normaler Holzstuhl und meine Gäste sich nicht fühlen sollen wie Kleinkinder an einem Tisch für die Großen. Wenn man auf dem Sessel sitzt, geht der Tisch einer Erwachsenen etwa bis kurz über den Bauchnabel. Meinen Computer mit der Audiosoftware Reaper und meinen Kopfhörern habe ich an die kurze Seite des Tisches gestellt, so dass Abstand zwischen mir und meinen Gästen besteht. Ich habe die Beine eines Holzstuhls gekürzt, damit wir auf gleicher Höhe sitzen und den Bildschirm so aufgestellt, dass Blickkontakt jederzeit möglich ist.
Gerade haben mein erster Gast und ich aber keinen Blickkontakt, ich mache Tee, eine Tasse für sie und eine für mich. Dann kann sie sich in Ruhe im Raum umsehen, während sie auf meinem Sessel sitzt und ich ihr den Rücken zuwende. Als ich mich umdrehe, tupft sie sich gerade mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. „Die Chemo“, lächelt sie verlegen. Ich lächle zurück. Gesellschaftliche Konventionen. Ich ahne, dass wir die heute noch überwinden werden. Für den Anfang sind sie aber eine gute Stütze. Sie klemmt den Kragen ihres T-Shirts zwischen drei Finger und fächert sich mit dem Stoff Luft zu. „Ich habe ständig Hitzewallungen.“ Zum heißen Tee stelle ich ihr noch ein Glas Medium-Mineralwasser aus dem Kühlschrank hin. Und mir auch.
Ich setzte mich an den Tisch hinter den Bildschirm. Was wir vorhaben wird anstrengend sein und lange dauern. Deshalb verzichte ich auf das langsame verbale Abklopfen, das oft in der ersten halben Stunde einer neuen Begegnung stattfindet. Mein Gast hat nicht mehr viel Zeit und nicht mehr viel Kraft, beides möchte ich nicht verschwenden. Deshalb frage ich nur, ob sie noch etwas wissen möchte, erkläre ihr die Technik, lasse sie einmal mit und einmal ohne Kopfhörer sprechen, sodass sie mir sagen kann, was ihr lieber ist. Sie entscheidet sich für die Kopfhörer, was mich überrascht. Ich setzte mir auch Kopfhörer auf.
Sie holt Notizen aus ihrer Tasche und legt sie auf den Tisch. Ihre Hände zittern, in der kurzen Zeit, in der ihre Notizzettel zwischen Tasche und Tisch schweben, rascheln sie wie Herbstlaub. Wir beginnen mit einem Audiotest. Sie blickt verlegen auf das Mikro und sagt hilflos test, test. Ich frage sie, ob ihr Sommer oder Winter lieber ist. Sie ist überrascht aber antwortet und gewöhnt sich an den Klang ihrer Stimme über die Kopfhörer. Ich überprüfe die Aufnahme am Computer. Alles funktioniert.
Es kann losgehen.
Flatternde Hände, flatternde Stimme. Soll ich einfach vorne anfangen?
Wo du möchtest. Wir sind längst beim Du, waren eigentlich gar nie wirklich beim Sie. Erzähl, was du erzählen möchtest, und wenn du dir etwas anders überlegst, können wir jederzeit von vorne anfangen.
Sie nickt und räuspert sich. Blickt auf ihre Zettel, auf den Tisch vor sich. Gerade ist es sehr wichtig, dass zwischen ihr und mir das Mikrofon und der Bildschirm stehen und dass wir beide Kopfhörer tragen. Ich bin da und ich bin nicht da. Zusammenreißen, nicht zerfließen. Zusammengerissen. Sie ist jetzt bei sich und erzählt. Ihre Stimme zeichnet Wellen auf meinen Bildschirm, Wellen, die nicht für mich sind, über die ich aber wache. Wellen, hinter denen sich ihre Kindheit versteckt: Vater, Mutter, keine Geschwister. Sie geht chronologisch vor. Ihre Jugend, ihre erste Liebe, ein anderer Ferienarbeiter aus der Eisdiele. Kommt und geht. Die Wellen auf meinem Bildschirm, gleichmäßiges Auf und Ab.
Drei Jahre waren wir zusammen, kannst du dir das vorstellen, Maren? Ich hätte mir das mit 16, als wir zusammen Eis verkauft haben, nie vorstellen können, drei Jahre kamen mir so ewig vor, viel zu ewig. Aber gleichzeitig dachte ich auch wir würden für immer zusammen sein und heiraten. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, ich verstehe es selber nicht. Sie spannt ihre Schultern an, nichts was das Meer auf meinem Bildschirm abbildet. Dann spricht sie wieder: Aber drei Jahre waren zu lang.
Die symmetrischen Wellen breiten sich weiter an ihrer Linie entlang aus, ihr erster Freund verschwindet aus ihnen, ein FSJ im Ausland verbirgt sich jetzt hinter den Formen. Die Rückkehr nach Deutschland, studieren oder nicht? Dann ein Stocken. Auf meinem Bildschirm: Ebbe. Nur noch die Nulllinie, die allein ihren Weg von links nach rechts sucht. Ich schaue fragend an meinem Monitor vorbei. Mein Gast spielt lautlos mit ihren Fingernägeln am Rand ihrer Notizzettel herum, die sie bisher kaum angesehen hat. Sie weiß ja alles, was darauf steht. Sie hält inne in ihrer Bewegung und atmet scharf aus. Wieder eine Welle.
Und dann hatte mein Vater Sie stockt, lächelt kurz, als fiele ihr das gerade zum ersten Mal auf, dein Opa! einen Unfall. Die Geschichte kennst du sicher schon, Maren. Er hat sein Bein verloren, das linke, musste am Oberschenkel amputiert werden. Das weißt du sicher auch. Zumindest bist du gerade, also jetzt als Dreijährige, ganz beeindruckt von seiner Prothese und seinem Stumpf. Er hat mal ein Gesicht für dich auf seinen Stumpf gemalt, mit Edding. Das fandest du lustig und gruselig gleichzeitig. Wir haben Videos von dir gemacht, frag mal Papa. Aber die hast du wahrscheinlich schon alle gesehen.
Sie verliert sich in dem Meer, das sich über meinen Bildschirm ausbreitet, dessen Wellen in drei verschiedene Zeiten branden. Aber ich greife nicht ein. Und sie findet sich wieder.
Er hatte den Unfall. Und es ging ihm so schlecht, er was so traurig. Er ist doch immer so gern Fahrrad gefahren. Und Mama war so traurig. Sie wusste gar nicht, wo sie hinschauen sollte, wenn wir Papa im Krankenhaus besucht haben und er dort in seinem Rollstuhl saß ohne sein linkes Bein. Er hatte ja da noch keine Prothese. Und ich war so wichtig, für Mama und für Papa. Wenn ich da war, dabei im Krankenhaus, dann war die Stimmung nicht so gedrückt. Dann war da irgendwie weniger Traurigkeit. Schon wenn ich nur kurz aufs Klo gegangen bin, war danach so viel Schwere in dem kleinen Krankenhauszimmer. Und dann
Sie atmet schwer, so schwer, dass das Meer nicht von meinem Bildschirm ebbt.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Studienplatz, Maren. Ich wusste nicht mal, was ich überhaupt studieren wollte. Ich hätte noch ein Jahr oder wenigstens ein halbes zu Hause bleiben sollen. Für Papa da sein. Und für Mama. Aber
Nulllinie
Ich hab es nicht ausgehalten. Ich hab mich für den ersten Studienplatz eingeschrieben, für den es noch nicht zu spät war, in der übernächsten Großstadt und dann bin ich weggezogen. Deine Großeltern haben nie etwas gesagt, aber
Die Wellen werden klein, unregelmäßig. Mein Gast weint. Ich schlage eine Klopause vor. Sie stimmt zu. Ich stoppe die Aufnahme, mein Gast nimmt ihre Kopfhörer ab, steht auf und verschwindet kurz.
Ich sehe, dass sie sich auf dem Klo kaltes Wasser ins Gesicht gespritzt hat, ihr Haaransatz ist nass. Oder es ist der Schweiß, wegen der Chemo. Sie setzt sich wieder auf meinen Sessel und macht sich ganz klein hinter dem Tisch, während sie angestrengt auf ihre Notizen starrt, die jetzt zerknittert auf dem Tisch liegen. Sie fühlt sich verletzlich, weil ich jetzt so viel weiß. Ich stehe auf und mache eine zweite Runde Tee, während ich ihr sage, dass ich beeindruckt von ihr bin und sie das super macht. Anspannung fließt aus ihrem Körper. Nicht die ganze, aber es ist ein Anfang. Wir können weitermachen.
Was sie vorhin gesagt hat und auch was sie nicht sagen konnte, lässt sie so stehen. Geht weiter im Text, tastet mit ihrer Stimme nach und nach ihr ganzes Leben ab. Sie erzählt von ihrem Studium, einem abgebrochenen und einem abgeschlossenen. Erzählt von Freundinnen, wie sie ihren Mann kennengelernt hat, in dem Chor, den sie eigentlich schon längst hatte hinschmeißen wollen, den sie nur noch besuchte wegen des Stammtischs, der ab und zu danach stattfand. Und warum sie einmal ein Jahr lang nicht mit ihrer Mutter gesprochen hatte.
Immer wieder verändert sich der Seegang des Audiomeers, verschwinden die Wellen oder wird es unruhig, weil sie stockt, ihre Stimme bricht oder sie sich in einer Satzsackgasse verläuft. Ich ermutige sie dann, weiterzumachen, bis ich irgendwann merke, dass es heute nicht mehr geht. Morgen wird sie nochmal kommen. Sie behandelt mich jetzt wie eine Freundin und ich behandle sie auch so. Alles andere wäre unfair, jetzt wo ich so viel über sie weiß. Sie umarmt mich zum Abschied.
Als sie am nächsten Tag an meiner Tür klingelt, habe ich den Computer schon eingeschaltet und Reaper gestartet. Der Tee steht auch schon auf dem Tisch. Ich weiß, es wird wieder ein langer Tag und sie hat nicht mehr viel Zeit, also bin ich effizient.
Heute ist sie nicht nervös. Sie nimmt ganz selbstverständlich Platz auf meinem Sessel.
Aber je näher sie der Gegenwart kommt, desto öfter bricht ihre Stimme. Sie erzählt von ihrer Angst, von ihrem schlechten Gewissen nicht da zu sein, von ihrer Liebe.
Abends hat sie es geschafft. Sie hat alles gesagt. Ich merke, dass ihr das Angst macht. Diese Angst kann ich ihr nicht nehmen. Eine Sache mehr, die hinter ihr liegt und nicht mehr vor ihr.
Ihr Teil der Arbeit ist erledigt. Jetzt bin ich dran. 32 Jahre, zusammengefasst in 15 Stunden. Audiomaterial, das geschnitten werden muss. Verständlich und hörbar gemacht, für jemanden, den es jetzt noch gar nicht gibt: ihre erwachsene Tochter, die jetzt gerade drei Jahre alt ist und die sie mit 89-prozentiger Wahrscheinlichkeit niemals als Erwachsene kennenlernen wird. Ich sage ihr, ich brauche eine Woche. Ich arbeite zwar auch noch 40 Stunden als Rechtsanwaltsgehilfin, aber ich weiß, wie wichtig der Abschluss ist. Ich beeile mich.
Ich halte meine Frist ein. Das Hörbuch ist noch immer elf Stunden lang. Ich habe nicht viel geschnitten. Die Lautstärke und manchmal pfeifende s-Laute angepasst, Dopplungen herausgeschnitten, die Ankündigungen der Klo-Pausen und manches langes Schweigen zwischen Sätzen. Ich schicke ihr die Datei, sage ihr, dass sie ruhig Anmerkungen machen kann und ich noch alles verändern kann, was sie sich wünscht.
Sie antwortet vier Tage später. Sie hat Stellen aufgeschrieben, viele Stellen und fragt mich, ob ich die herausschneiden kann. Ich ahne was sie möchte, höre mir die Stellen an. Es sind die Satzsackgassen, das Schweigen, das Ungesagte, das Schwere, die Fehler, ihre Ängste, das Zittern und Brechen ihrer Stimme, das Flattern ihres Atems.
Sie kennt ihre Tochter nur als Dreijährige, sie will stark für sie sein. Unfehlbar. Das verstehe ich. Ich erstelle eine Kopie der ersten Version und schneide in der Kopie die Stellen heraus, die sie nicht mehr drinnen haben möchte.
Als ich fertig bin, ist aus dem Audiomeer eine Pfütze geworden. Von der Frau, die auf meinem Sessel saß, ist kaum etwas übrig. Die Schablone einer perfekten Mutter, ein Schatten.
Ich kenne diesen Schatten. Er lag auf jedem meiner Fehler und hat sie noch dunkler gezeichnet. Ich bin die Tochter einer Märchenprinzessin, die ein furchtbar fehlerhaftes Kind in die Welt gesetzt hat und dann gestorben ist.
Ich denke eine Weile darüber nach, ob ich es verantworten kann, ihr etwas so Persönliches aufzutischen. Ob ich ihr sagen darf, dass ich weiß, wie es ist – ich denke an ihre Tochter und entscheide mich dafür.
Sie antwortet nicht und obwohl wir so ein freundschaftliches Verhältnis hatten, habe ich Angst, dass meine Nachricht zu viel für sie war und ich sie verschreckt habe. Dann wäre unsere ganze Arbeit umsonst gewesen. Aber dann kommt doch eine Mail. Von ihrem Mann. Es ging alles noch schneller als befürchtet. Er bedankt sich für meine wertvolle Arbeit, versteht auch meine Einwände, möchte aber den Willen seiner Frau respektieren. Er bittet mich, ihm die gekürzte Version zu schicken.
Ich denke lange nach.
Vertrauen ist das wichtigste.
Ich antworte ihm, dass ich ihm die Aufnahmen per Post zuschicke. Ich brenne die gekürzte Version auf CD, dann erstelle ich ein CD-Cover, um es in die Hülle zu stecken. „Für Maren“ steht vorne groß in der Mitte, sonst schreibe ich nichts darauf. Ich falte das Papier einmal, sodass ein Mini-Booklet entsteht. Auf die Innenseite des Covers schreibe ich mit Bleistift meine Mailadresse. Das war der leichte Teil. Dann: „Liebe Maren, ich habe das Hörbuch mit deiner Mutter aufgenommen.“ Ich überlege, lange, dann schreibe ich weiter. „Sie hat noch mehr für dich eingesprochen, als du bisher gehört hast. Wenn du bereit bist, mehr Dimensionen deiner Mutter kennenzulernen, melde dich bei mir, dann schicke ich dir die Dateien zu.“ So lasse ich es. Dann Zweifel. Ich drucke das Cover nochmal aus.
Währenddessen klebe ich die Seiten des ersten Covers zusammen, nur mit zwei Strichen meines Klebestifts – hoffentlich so, dass es jemandem nicht auffällt, der die CD auspackt, im Kopf die Planung einer Beerdigung und die Versorgung einer dreijährigen Tochter, für die er die CD, dem Willen seiner verstorbenen Frau entsprechend, an einem sicheren Ort verwahrt, um sie 15 Jahre später einer fast erwachsenen Tochter zu geben.
Aber hoffentlich so, dass es einer jungen Frau auffällt, die in 15 Jahren nervös und vielleicht sogar ein wenig widerwillig die CD in einen CD-Player legt. Die dann mit unruhigen Händen an der Hülle herumfummelt, während sie einer Stimme zuhört, die ihr unendlich viel bedeuten sollte, ihr aber vor allem fremd ist, die dann, fast ohne es zu bemerken, das Booklet aus der Hülle nimmt und mit ihren Fingernägeln am Papierrand des Booklets herumnestelt, während sie hofft, dass die Stimme, die in die CD eingebrannt ist, das sagen wird, was sie braucht, ohne selbst zu wissen, was das ist.
Die nervösen Finger von so einer Frau müssten doch irgendwann die dünne Klebstoffschicht getrennt haben und meine Nachricht entdecken, oder? Oder ich verwende doch das zweite Cover, ohne meine Bleistiftnachricht. Ich nehme es aus dem Drucker, schneide es zurecht, falte auch diese Version in der Mitte und lege es zum anderen Cover auf den Tisch.