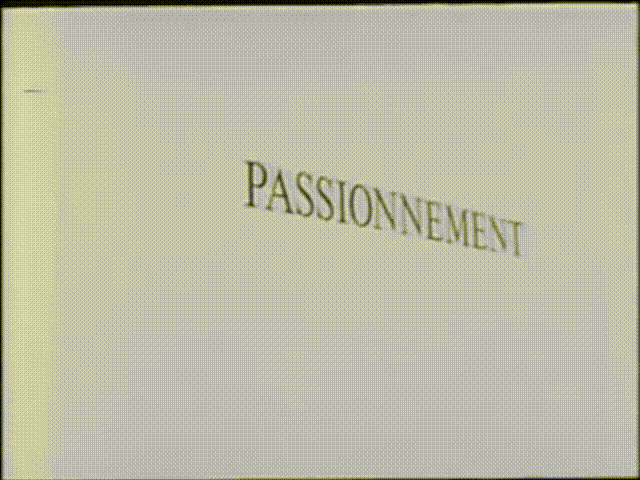Er stottert “Ich liebe dich” und es dauert Seite um Seite, bis der Satz endlich heraus ist. Bis dahin ist alles, was zu diesem Satz gehört, gespalten und zersplittert, so notwendig, wie es in einer Sprache nicht anders geht. Das Stottern ist auch ein Statement gegen den Tod, ein Stottern, um nicht sterben zu müssen, um immer weiter zu sprechen, die Worte aufzuspalten, damit sie nicht zu einem Ende kommen.
↓
Hören und Lesen geht in Gherasim Lucas Texten zusammen. Man sucht sich die Stauchungen und Überblendungen der Worte, während er in einer anderen Sprache spricht, die ihm so wenig vertraut ist wie uns. Das ist die Nähe des Akzents im Französischen und das ist die elementare Geste des Stotterns, das nichts ist als ein Suchen. Er sucht, was noch nicht gesagt ist und was er selber noch nicht weiß. Im Stottern entsteht etwas, was es noch nicht gibt, nicht als Idee und nicht als Satz. Statt dessen gibt es Knoten und Verzweigungen.
↓
Wie kommt man hinein in eine fremde Sprache? Wie kann man dieses Eintreten zeigen? Luca, der “Étran-juif”, hat das Befremdetsein zum Schreiben gemacht. Und umgekehrt. Die Sprache wird nicht destruiert, sondern angerauht, angelöst, porös. Ohne Ende und ohne Anfang. Sie wird beim Wort genommen. Das ist Lucas Praxis. Das sind mehrere Sprachen zugleich, eine mehrsprachig imprägnierte Dichtung.
↓
“die verzweiflung hat gar kein paar beine / absolut kein paar beine / absolut keine absolut keine beine / aber absolut keine beine / absolut drei beine”.
↓
Die Sprache, das ist die Verzweiflung, das ist, was Luca “Ma déraison d’être” genannt hat. Verzweiflung und Einsamkeit, als surrealistischer Poet in Rumänien, mit Kanten und Katastrophen, dann als Stotterer in Frankreich. Viele Jahre ohne Namen und Papiere. Sein Zögern und dann das Immer-wieder-hineinkommen wird zum Rhythmus. Lange Gedichte, manchmal so, als würde, in lauter Punktierungen, etwas erzählt, mit vielen Unds und Abers und Auchs. Sie binden, was klingt, in eine “Ontophonie” (Luca): “Es bereitet mir Schwierigkeiten, mich in sichtbarer Sprache auszudrücken.”
↓
Der Körper der Sprache setzt sich aus Lauten zusammen. Einzelne Körperteile werden abgetrennt und in Wörter verwandelt. Das Leben, diese Sprache, befindet sich in einem offenen Zustand. Pas pas. Kein Schritt. Nichts geht voran. Und doch. Die Wörter wollen die Liebe und werden doch gleich wieder zurückgenommen. “Ich durchlaufe heute einen Stimmraum, in dem der Lärm und die Stille einander anstoßen – Stein des Anstoßes -, in dem das Gedicht die Form der Welle annimmt, die es in Gang gesetzt hat. Besser, das Gedicht verdrückt sich vor seinen Folgen. Mit anderen Wort: Je m’oralise.” Ich verlautliche mich. Ich veräußere mich.
↓
Die Sprache wird angestoßen und dann diskret gelenkt. Sie bringt etwas hervor, etwas Unsägliches, was sich sonst verweigert ausgesprochen zu werden. Das Unsägliche ist dem, was gesagt wird, zum Verwechseln ähnlich. Und das führt zu nichts. Es gibt nur Verzweigungen, Schlaufen, Echos. “So kommt es, dass ich lebe / was ich sehe / und dass meine Rede oder Stimme sich annimmt / des Ichs, das erlischt.” Er hat in Höhlen gewohnt, weil er sich verstecken musste. Luca war bereits 81 Jahre alt, als, angeblich “aus Hygienegründen”, die Räumung seiner Wohnung angeordnet wurde. Luca hatte sich seit vierzig Jahren ohne Papiere in Frankreich aufgehalten und konnt nichts dagegen unternehmen. Am 9. Februar 1994 nahm er sich in Paris das Leben.
↓
“Ausgestreckt über der Leere / knapp über dem Tod / gespannte Ideen / der Tod ausgebreitet über dem Kopf / das Leben von zwei Händen gehalten // Zusammen die Ideen heben / ohne die Vertikale zu erwarten / und zur selben Zeit das Leben mitnehmen / vor die ziemlich gespannte Leere / Eine gewisse Zeit zum Innehalten bestimmen / Und Ideen und Tod in ihre Ausgangsposition bringen / Nicht die Leere vom Boden ablösen / Ideen und Tod gespannt betrachten”
Ghérasim Luca: Das Körperecho / Lapsus linguae. Gedichte Französisch und Deutsch, übersetzt von Mirko Bonné / Theresia Prammer und Michael Hammerschmid. Urs Engeler Editor 2004, 792 Seiten.