Wie kann man gehen? Taumelnd, querfeldein, entlang wenig spektakulärer Wege, immer gleich und zugleich immer wieder anders. Was passiert, wird passiert. Das hört sich an nach Wortgeklingel. Doch zu den lyrischen Passagen Michael Donhausers gehört auch, was man im Gehen riecht und schmeckt, was man hört, die Erschütterung jeden Schritts, jeder Hebung und Senkung von Füßen und Silben, halb im Taumel, und doch nie wirklich im Zweifel, ob es gelingt. Was soll hier gelingen? Das Gehen, das Schreiben? Kann man so das Gelingen des Selbstverständlichen in Frage stellen? Diese Dichtung hat das Gehen als Programm, „Silben wie Schritte“ heißt es einmal, hinein in eine „Wegstückaura.“ Kein Walserscher Spaziergangswahn, kein von Gewaltphantasien geplagter Flaneur: Nur ein beharrlicher Sprach-Seismograph, mit Gerard Manley Hopkins und Peter Waterhouse als Genossen, auf dem Weg durchs Sarganserland. Eine halb versteppte Landschaft von Erinnerungen, Gefühlen und Lektüren.
Im Gehen kommen die Erinnerungen, von Zufällen gesteuert, von Hindernissen, die noch der sanfteste Hügelweg bereit hält. In behutsam-knappem Rhythmus lesen wir mit einem Mal von Empfindungen, ganz so als würde ihnen ein halblautes ‘Klopstock!’ entweichen, gebunden in eine rhetorische Schleife, die sich zunehmend als Dämpfer, als Kondensator erweist, „wie berührt“ – Betonung auf dem „wie.“ Im Sarganserland ist gut vergehen, „mitten durch / den Verlust“ und statt Heideggerscher Feldweg-Redundanzen läßt uns Donhausers spätwinterlicher „Felderweg“ frieren, inmitten von Stauden, Zweigen und Schienen. Eine postidyllische Welt voll abgesägter Konjunktive, deren melancholischem Zugriff jede Verständigung entgleitet, insbesondere die zwischen Liebenden.
„Den Abend / als sagten / die Farben / als läge // Der Garten / beflügelt / als wären / oder wagten // Die Blätter / die Tische / die Blüten / ein Kaum.“ Bei Donhauser kann ‘vergehen’ eine Bewegung sein: „Wahllos / verging ich / es blättert / der See // Die Wellen / ans Ufer / wie Blüten / das Meer.“
Zu schön manchmal, um wahr zu sein, gerettet immer wieder von der spröden Einsilbigkeit, mit der sogar ein „Ach!“ wieder lesbar wird, gerade noch, wie im Abschnitt „Ein Stück später“, dem gleichwohl schwächsten des Buches. Da scheint er im lyrischen Vanitas-Topos der flüchtigen Begegnung nur die üblichen Verdächtigen finden zu können. Bordeaux, Regennacht und Filterstummel heißen hier die zuständigen Etiketten, „unbetört“ wie Donhauser, eigentlich wissend, vermerkt. Aber das bleibt ohnehin ein Einwand von leichtem Gewicht, leicht aufzuheben von der Bewegung, in die Donhauser seine lyrischen Liebenden versetzt. Und wann wurde das letztmalig so gehört, gelesen: „Wieder, noch, einmal“ – so tönt der Rhythmus in stetem Dreischritt.
Ein aufmerksamer Gang, in bedächtigem Tempo, immer wieder wankend, beständig und mit Unterbrechungen. Die Umgebung wird zum Gestöber kaum verbundener Intensitäten und immer schwieriger wird es, sich darüber zu verständigen. „Welches // Wort, fragte ich, würde das erste hier / sein“, lautet die Frage und, daß die Frage sich nur nachträglich stellt („es war eine Sprache“), läßt sich angesichts der kargen Präzision dieser Verse unschwer – und das zu ihrem Vorteil – vermuten. Immer scheinen sie mit einem Zögern an Mauern, Birken und Schatten entlang, „bewegt von // Weither, Wissen, Ziegel, Ödnis“ – wenn es das gibt, genau in dieser Reihenfolge. Der Ödnis soll, so wird gesagt, die Stimme dieser Dichtung angehören.
Das geschieht in einer Form von Reduktion, die nichts von Formalismus und Mutwilligkeit hat, weil sie sich in der Bewegung vollzieht, als das Gehen, das sie thematisiert. Das geschieht auch mit dem Anschein des Flüchtigen, wohl inszeniert wird jeder Vers ein Ausschnitt, etwas Liegengebliebenes und Wiedergefundenes, gleichsam eine Spur. Das sind Spuren wie Scharniere, um Kommata als Gelenkwindungen herum, mit denen es aber auch kaum ein Halten gibt, sie verhallen, allenfalls eine tastende Ahnung bleibt von dem, was bei uns nur mehr echohaft ankommt, „alles ist / alles fehlt.“
Den Zusammenhang stellt scheinbar der letzte Abschnitt des Bandes her mit einem Stück lyrischer Prosa. Alles, was vorher gesagt wurde, taucht hier wieder auf, doch nicht in bloßer Addition, verwandelt eher mit einem kühl-emphatischen Imperativ: „schneie, sinke, sei.“ Donhausers lyrischer Schreibgang führt über einen kargen, ebenso vertrauten wie von existentieller Verfinsterung bedrohten Winterweg, eine nächtlich schläfrige Straße eigentlich, mit einer leichten Kurve, deren Verlauf eigentlich gewiß ist, die doch immer so viel verspricht, daß sie minutiöses, schneckenhaft dramatisches Phantasieren auslöst.
„Nachtlandstraße im Sarganserland, eine Scheinwerferlänge Asphalt und Mittelstreifen und Saumgras und im Ahnungsbereich eine Kurve, dann sichtbar: das Bild zeigt, verschneit, was in Sekunden, die Geschwindigkeit herabsetzend, ein Wiedererkennen ist, der Unwiederbringlichkeit.“
Es geht nicht anders, mit jedem Schritt, der immer nur wie Wiederholung ist und zugleich immer neu, macht die Dichtung Michael Donhausers sich das mühsam konzentrierte Wiedererkennen zur Aufgabe. Genauer läßt sich kaum sagen, was sich notwendigerweise nicht entscheiden läßt. „Der Weg führt ins Bild, führt im Bild um eine Kurve, bis dorthin noch, dachte ich, würde ich gehen und dann, in der Kurve, würde sich zeigen, wohin der Weg führte: so ging ich und war ich bis hierher gekommen und so immer unentschlossener, umzukehren, zurückzugehen.“
Michael Donhauser: Sarganserland. Urs Engeler Editor. 87 Seiten.



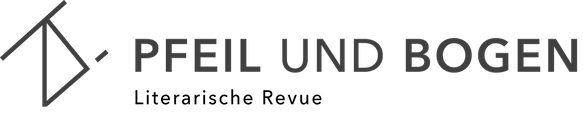

![Steve Jurvetson - [1], CC BY 2.0](https://pfeil-undbogen.de/wp-content/uploads/2017/04/Fiber_optics_testing-e1493370847178-560x420.jpg)








