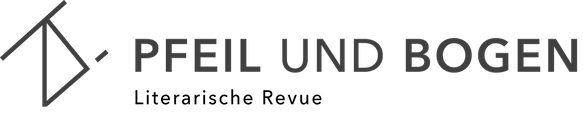Bücher, Autoren, Herausgeber, Experten müssen, wenn sie an ihre Rolle glauben, in dem, was sie sagen, widerspruchsfrei sein. Inkonsistenzen, Fehler und alternative Fakten sind peinlich. Der Peinlichkeitsindex steht und fällt damit, ob man ertappt wird oder nicht. Vor allem aber hängt er daran, dass solche ein Gebot, um jeden Preis widerspruchsfrei sein zu müssen, in der Erzähllogik oder in der Argumentation, an der Autorität hängt, die bestimmte Rollen beanspruchen. Wenn sie aus der Rolle fallen, verlieren sie ihren Status.
↓
Aber wenn es diesen Status gar nicht gibt, bedarf es auch nicht der Rollen. In Netzwerken etwa bildet sich Autorität anders heraus. Ideen und Wissen werden nicht hierarchisch verhandelt. Jemandes Argumentationen zu vertrauen, weil sie oder er ein Buch dazu geschrieben hat, ist etwas grundlegend anderes als dieses Vertrauen auf ein Netzwerk zu gründen. Es werden andere Werte ins Spiel gebracht. Ambivalenz und Fülle und Transparenz: was Wissen sein kann, stellen immer andere zur Verfügung und das auch nur vorläufig. Die Verbindungen zählen und das, was zwischen ihnen ist.
↓
Das ist, was Latour das Soziale nennt. Das, was nach den Tatsachen kommt. Oder besser: was neben und mit ihnen da ist, der Kontext. Wie also mit Ordnungssystemen gearbeitet wird, um daraus Bedeutung zu generieren. Bedeutung ist nicht notwendig mit dem verknüpft, was ist, sondern Praxis. Siehe Wittgenstein. Eben so werden Räume, Ideen und Information hergestellt. Handlungsspielräume: induzierte Möglichkeiten, die tatsächlich vorhanden sind. In einem so verstandenen Kontext spielt alles mit, was Handlungen induziert oder induzieren könnte: Dinge ebenso wie Menschen, Abstände genauso wie Grenzen.
↓
Das Schwierigste aber sind die Spielregeln. Die Emphase der algorithmischen Verknüpfbarkeit allein reicht dafür nicht aus. In der Einsamkeit der losen Enden, aus denen das Netzwerk eben auch besteht, ist für Solidarität, für Dauer und Verlässlichkeit, für Schutz und Toleranz wenig Raum. Für Dirk von Gehlen geht es darum, dass man selbst imstande sein muss, die Spielregeln zu schreiben.
↓
Beim Lesen von Dirk von Gehlen: Meta! Das Ende des Durchschnitts. Matthes Seitz 2016. 180 Seiten.