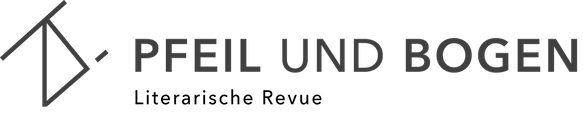Am Anfang ein Sturm, der alles durchdringt. Die Schultern des Pferdes sind sein Joch. Es zog und zog dann nicht mehr. Der Boden hatte nachgegeben. Es ging nicht mehr weiter. Schläge, die auch nicht weiter halfen, waren die Folge. Tränen, Leid und Mitleid, vom Pferd bleiben nur Konturen. Um sie herum haben sich alle Farben zurückgezogen. Es gibt keine Hoffnung mehr, nur eine lange, große Müdigkeit. Die einfachsten Dinge funktionieren nicht mehr. Es ist still, das Pferd trinkt und frisst nicht mehr, der Brunnen gibt kein Wasser mehr, es wird dunkel und kalt und auch der Sturm ist vorüber.
Alles geht durch die Konturen hindurch und das Nichts leuchtet. Das ist seine eigentliche Bestimmung. Die Leere, die Wiederholungen, das alles aufsaugende Grau, die Reste der Konstruktion, die Langsamkeit. Ein fahl leuchtender Saft windet sich da hindurch. Dieses Nichts ist ein Konzept, das uns erschreckt und wie ein weicher Zaun umgibt, zerstört und beschützt. Etwas ist falsch hier inmitten lauter Wahrheiten, zwischen Schatten von Schatten. Doch es ist, als ob man blind wäre, wenn man hinschaut.
Einmal war da etwas und vielleicht sind noch Spuren zu finden, wenn man lange genug hinstarrt. Dass es sie nicht gibt, wird gezeigt. Und dafür, dass etwas verschwindet, muss es keinen Grund geben. Es passiert. Einfache Handlungen. Sie sitzen und warten, stehen auf und starren aus dem Fenster, sie schlafen und decken den Tisch, sie essen und starren und warten. Alles, was nicht passiert, geht durch das Pferd hindurch. Nichts wird erklärt. Immer geht nur etwas vor sich und dann nicht mehr. Die Wiederholung des Immergleichen ist kein Spektakel, sondern ein Prozess, über den nichts hinausgeht.
Die Zeit, die vergeht, stellt keine Aufgabe. Das Starren ist das Vergehen. Es wird. Das Warten, die Langsamkeit. Da ist nichts, was nach einer anderen Aufmerksamkeit verlangt. Wir sehen uns satt an den schwarzen Punkten und den schwarzen Linien und beginnen zu erblinden. Die Träume erblinden, nichts, wovor es sich noch zu verstecken lohnen würde, wo “Ideale fabrizirt” werden. Wir müssen “verwunden, um Arzt zu sein”, und indem wir den Schmerz stillen, “den die Wunde macht, vergiften wir zugleich die Wunde”. Wir sehen nur die zerbrechliche Macht des Falschen.
Wir wissen, mit letzten Worten, nichts und wimmern: „Mutter, ich bin dumm“. Wir fürchten das Mitleid. Wir sind dumm gegenüber dem Mitleid, dem Pferd, das sich nicht wehren kann, aber sich weigern und aufgeben. Eine Schöpfungsgeschichte, deren Ende wir bereits nach sechs Tagen entgegen starren.
Bela Tarrs Film Das Turiner Pferd von 2011 soll, so erklärte der Regisseur, sein letzter sein.