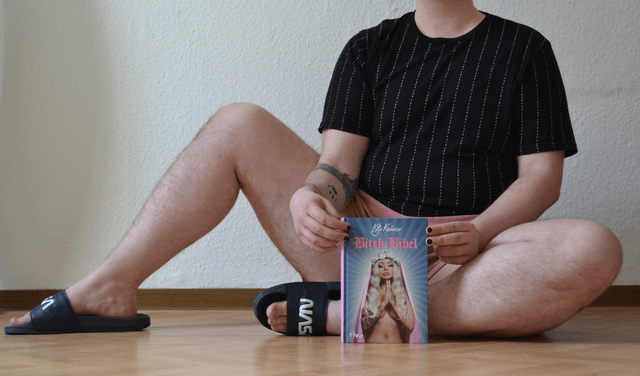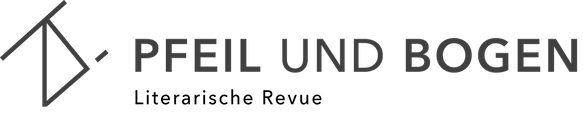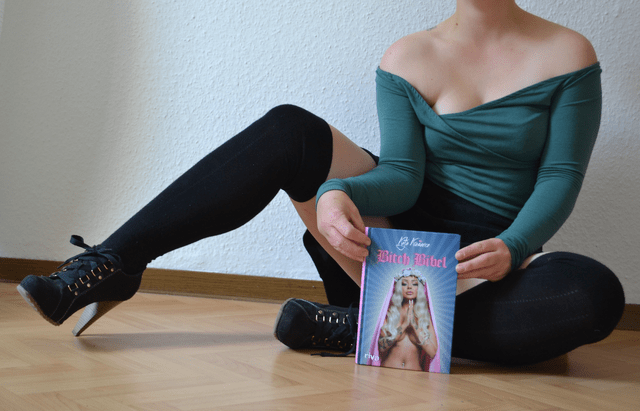Am 03.06. dieses Jahres erschien im Riva Verlag eine Autobiografie, an der sich die Geister scheiden – das habe ich vor allem erfahren, als ich das Erstlingswerk bei einigen Zoom-Treffen und WhatsApp-Videocalls begeistert in die Kamera hielt, nachdem ich es zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Die Reaktionen meiner Freund*innen fielen eher ernüchternd aus.
„Respekt, dass du es erträgst, das zu lesen. Ich könnte das nicht, mich mit so jemanden auseinanderzusetzen“, wurde mir gesagt. Und: „Wusste gar nicht, dass du so jemand bist.“ Schon zuvor war ich ein Fan* der dreiundzwanzigjährigen Autorin, die als YouTuberin begann und sich mittlerweile vor allem als Musikerin etabliert hat. Vielleicht fühlte ich mich deswegen dazu verpflichtet, meine metaphorische Detektivmütze aufzusetzen und der folgenden Frage nachzugehen: Was genau ist an ihr eigentlich so schlimm?
Die folgenden Tage verbrachte ich damit, das Buch systematisch durchzuarbeiten, meinen Freund*innen verschiedene Auszüge daraus vorzulesen, ohne ihnen im Vorfeld die Quelle zu nennen und ihre Reaktionen zu sammeln. Einige meiner Lieblingsstellen möchte ich euch nicht vorenthalten:
Ich frage mich oft, wie es sein kann, dass eine Frau wie ich, die offensiv mit ihrer Sexualität umgeht, gesellschaftlich immer noch verachtet wird, und das, obwohl die Welt allseits nach feministischer Autonomie schreit. Die Selbstbestimmtheit der Frau wird überall gefordert und gefeiert. Sie soll sich ihre Sexualität zurückerobern, sich nicht vom Mann abhängig machen, soll alle ihre Ziele erreichen und das von Männern dominierte System überwinden. […]
Und auch wenn die Rechtssprechung heute weiß: „Nein heißt Nein“, sind der kurze Rock und der tiefe Ausschnitt noch immer ein Kriterium zur Abwertung. Dies ist einer der Gründe, weshalb ich mit meinem ständigen Provozieren auch aufrütteln will. […]
Eine „emanzipierte“ Gesellschaft muss es ertragen können, wenn eine Frau über Sex redet, Künstlichkeit feiert und sich der Klischees bedient, die andere vielleicht als Zeichen männlicher Unterdrückung verstehen. Noch immer sehe ich ein abwertendes Lächeln, wenn ich auf sogenannte Feministinnen treffe. […]
Der Mensch ist von Natur aus nicht monogam, davon bin ich fest überzeugt. Die Gesellschaft hat uns irgendwann diktiert, so sein zu müssen, und das finde ich scheiße. […]
In meiner Welt ist Liebe nämlich kein Duett, sondern ein Chor. […]Katja Krasavice in Die Bitch Bibel – erschienen 2020 im Riva Verlag
Die Reaktionen, die auf diese Textstellen folgten, waren relativ einstimmig. Von „Das klingt toll, das will ich unbedingt lesen!“, über „Ja, da stimme ich zu, von wem ist das?“ bis hin zu „Klingt auf jeden Fall nach einer coolen Frau“, wurde die ganze Bandbreite des positiven Feedbacks abgedeckt.
„Das ist aus der Bitch Bibel von Katja Krasavice“, antwortete ich dann immer und hielt das Buchcover, auf dem die Autorin sich beinahe nackt präsentiert, erneut fröhlich in die Kamera. Und dann wollte ich wissen: „Was findest du an ihr eigentlich so scheiße?“

Die Standardreaktion darauf war eine Mischung aus Schulterzucken und: „Hm, naja, hm, du weißt schon, sie halt, so ganz generell“. Im weiteren Gesprächsverlauf habe ich dann oft herausgefunden, dass meine Freund*innen sich schlichtweg nie wirklich mit ihr beschäftigt haben und sie be- und verurteilen, da sie als Person auf den ersten Blick nicht in ihr Weltbild passt.
Ich verfasse hier kein Manifest für Katja Krasavice. Don’t get me wrong. Katja Krasavice nutzt definitiv wiederholt problematisches Vokabular und tätigt innerhalb der Bitch Bibel und auch in ihrer Musik Aussagen, die nicht oder nur schwer vertretbar sind: besonders in manchen Songs adaptiert sie das typische Vokabular der (Deutsch-)Rap Szene, das als Ganzes unbedingt kritisch betrachtet werden muss.
Zudem legt sie – oder ihr(e) Ghostwriter(*innen?), aber das ist eine Diskussion, die an dieser Stelle zu weit ausufern würde – einen teilweise weirden Sprachhabitus an den Tag. Beispielsweise ist eine immer wieder auftretende Figur in der Bitch Bibel ihr bester Freund Max, von dem sie jedes einzelne Mal wieder betont, dass er schwul ist, was den Lesefluss spätestens ab dem dritten Mal auffällig unterbricht. Als Fan* wusste ich schon vorher, dass Krasavice ein Ally der queeren Community ist und sich für mehr Akzeptanz und Diversity ausspricht – als Leser* war es mir unangenehm, wie sehr sie auf der Homosexualität von Max beharrte.
Ein weiteres Sprachmuster sehe ich in dem pädagogischen Auftrag, von dem es so scheint, als habe Krasavice ihn sich selbst auferlegt und ihn akribisch in jedes ihrer zehn Kapitel, die sie die „zehn Gebote“ nennt, eingearbeitet.
Erzählt sie von einer verpfuschten Schönheits-Operation, die sie hatte, so rät sie den Leser*innen dazu, nicht ihre Fehler zu wiederholen und lieber mehr Geld in einer seriösen Klinik zu bezahlen. Erzählt sie von ihrem Drogenmissbrauch, so besteht sie darauf, nie mehr als Gras geraucht zu haben und rät ihren Leser*innen vom generellen Konsum von Drogen ab. Schreibt sie darüber, dass sie in ihrer Jugend ungeschützten Sex hatte, so bittet sie ihre Leser*innen nachdrücklich darum, stets auf Verhütung zu achten. Dieses Muster lässt sich schablonenartig über beinahe jedes Thema legen, das sie in ihrer Autobiografie verhandelt.
Über diese pädagogischen Ansprüche, die Profilierung als Supporterin der queeren Community und die teilweise cringy sexuellen Metaphern, mit denen das Buch arbeitet, lässt sich für 208 Seiten hinwegsehen. Was für mich während des Lesens gezählt hat, war die Message, die Krasavice mit ihrem Debüt zu vermitteln versucht: Sei immer du selbst, egal, was die anderen sagen. Mach deine vermeintlichen Schwächen zu deiner Marke. Kritisier das System, fick das System, lass es für dich arbeiten und dann schlag Profit daraus.