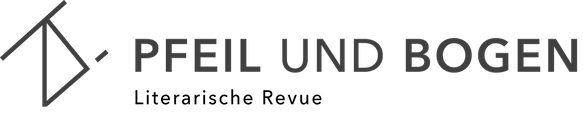Sage ich. Delius sagt nicht. Delius sagt, Angela Merkel kann keine Romanfigur werden, seine nicht, und damit zwar theoretisch noch die eines anderen, praktisch aber dann wohl eher nicht. Im dritten Sinn und Form-Heft dieses Jahres gibt Friedrich Christian Delius den Fortgang eines Interviews wieder, das eine Studentin mit ihm geführt hat, und man kann nur hoffen, dass dieses Gespräch tatsächlich einmal so oder so ähnlich stattgefunden hat, denn wäre diese brave, bemühte Masterstudentin nur eine Erfindung, sie wäre dem Frauenversteher Delius reichlich schwach und klischeehaft geraten.
Es beginnt ja gar nicht schlecht. Delius will eine klare Antwort auf eine klare Frage geben, das ist löblich, und mehr noch: es gelingt ihm; die Antwort verliert sich nicht in unentschiedenem Lavieren oder abstrakten Bemerkungen. Genau genommen fängt es sogar richtig gut an. Nicht spektakulär, aber eingängig legt Delius dar, was Literatur seiner Meinung nach ausmacht: eine eigene Perspektive, die sprachliche Spannung zwischen zwei Punkten, Unruhe und Verstörung, radikale Subjektivität. Das alles sei ihm bei Angela Merkel nicht möglich zu leisten, denn Merkel, jeder männliche oder weibliche Bundeskanzler, am meisten aber die „spannungsarme“ Merkel ermögliche höchstens geschicktes Handwerk und künstlerisches Beamtentum.
So geht es ihm mit Merkel, und so muss es also, legt er uns nahe, jedem anderen im Grunde auch ergehen; er spricht über die Zeitabstände, die zwischen Tolstoi, Fontane und Musil und den von ihnen literarisch behandelten Gegebenheiten liegen, und wenn er auch betont, etwa sein eigenes Werk „Die Birnen von Ribbeck“ sei im Verhältnis dazu natürlich nur ein „kleiner literarischer Zwischenruf“, so wird doch deutlich, was er meint: auch ihnen ist es nicht gelungen, eine sofortige literarische Aufarbeitung der geschichtlichen Ereignisse zu leisten, es ist also nicht seinem schriftstellerischen Unvermögen geschuldet, wenn es ihm bei Merkel nicht möglich ist.
So weit, so gut. Delius wehrt sich gegen künstlerisches Beamtentum, gegen das reine Chronistendasein des Schriftstellers, er hat höhere, ambitioniertere, poetischere Ziele – das ist eine ästhetische Position und ich kann sie respektieren, sogar nachvollziehen. Wenn ich auch als ehemalige oder immer-noch-, möglicherweise wissenschaftsenttäuschte, Historikerin nicht ganz einsehen will, dass der Künstler-Schriftsteller, wie Delius im Subtext deutlich nahelegt, „mehr“ bietet als der Chronist, ich würde doch bevorzugen zu sagen, er bietet etwas anderes, das dem einen mehr Befriedigung verschafft als die Chronik.
Gerade als so eine irgendwie-enttäuschte Historikerin, die sich dagegen wehrt, einen historischen Stoff in Geschichtenform aufzuarbeiten, hat mich die Frage aber doch von Anfang an interessiert: Kann sie, die ewige Kanzlerin, eine Romanfigur werden? Gerne hätte ich mich weiter damit auseinandergesetzt, was ein Roman ist, was ein journalistisches oder satirisches Porträt, wie ich mit echten Personen umgehe, die in diesem Fall zufällig beides sind: historisch und gegenwärtig. (Obwohl das ja im Grunde auf jede Person zutrifft).
Delius aber hat anderes im Sinn. Seine sokratisch angelegte, scheinbare Auseinandersetzung mit der Frage, ob realhistorische Personen Romanfiguren werden können, was also Literatur und Romane ausmacht, was ihre Figuren ausmacht, entwickelt sich im Verlauf des Textes mehr und mehr zu einer reinen Selbstreflexion des Autors Delius und seinem Desinteresse an der Person Angela Merkel. Milan Kundera beispielsweise ist es gelungen, es ist allerdings schon etwas her, sich mit ähnlichen Fragen auf eine für mich sehr anregende Weise auseinanderzusetzen
Die Frage „Ist es möglich?“ ist für Delius ein deutliches „Will ich über Angela Merkel schreiben?“, und wird schließlich schlicht zu einer politischen Abrechnung mit Merkel. Eine Subjektivität, wie sie ihm im guten Roman vorschwebt, ist ihm angesichts seiner Abneigung gegen Merkel, keine Möglichkeit etwas von Wert zu schreiben – auch das ist noch eine nachvollziehbare Position. Doch wird sein Gedankengang hier zunehmend diffus. Als Autor stellt er den Anspruch an sich, „literarisch neutral“ zu sein, und widerspricht damit doch in gewisser Weise dem Anspruch an die zuvor von ihm beworbene, radikale Subjektivität des Autors. Groll und Empörung, sagt er endlich, empfinde er gegenüber Merkel, und von da an wird es deutlich. Er reiht Argumente gegen Merkels Politik aneinander. Kurze Einschätzungen von politischen Sachverhalten, ales scheint klar und einleuchtend und selbsterklärend. Er hält Merkel, kurz gesagt, für eine politische Komplettkatastrophe, und das ist es im Kern, was ihn aussagen lässt, Merkel sei als Romanfigur generell ungeeignet. Zum Schluss gesteht er der Studentin folgende Romanmöglichkeit zu:
„Ein Roman über eine Frau, die, abgelenkt vom Kleinkrieg mit Urbayern und von urarabischen Konflikten, völlig übersieht, wie Europa im 21. Jahrhundert zur chinesischen Provinz wird.“
Das ist seine Perspektive auf Merkel. Ob nun politisch berechtigt oder nicht, er hat sie, diese Perspektive, und er legt sie deutlich dar. Er zählt die Punkte ihres Versagens klar auf, doch er gibt weder der Studentin noch dem Leser des Artikels die Möglichkeit des Widerspruchs. Für ihn liegen die Sachverhalte klar auf der Hand: Merkel ist empörenswert, eine kalte, egoistische, kleinkarierte Politikerin, die in ihrer Fixierung auf das Kleine und Falsche die großen Zusammenhänge einfach übersieht. Doch welchen Schluss zieht er nun daraus? Dass sie es nicht wert ist, Romanfigur zu werden. Er interessiert sich nicht für sie – sie ist nicht gut genug für ihn. Sie ist unter seiner Würde als Schriftsteller. Er, der den Anspruch hat, Kunstwerke zu schaffen und der im Gegensatz zu Merkel einen klaren politischen Durchblick hat, hat Besseres zu tun. Er kann beispielsweise über andere Frauenfiguren schreiben, sicher, an den Fähigkeiten mangelt es ihm nicht, so konnte er beispielsweise das Bildnis seiner Mutter schreiben.
Delius geriert sich als über den Dingen stehender Geist, im Grunde aber ist sein Artikel weit weniger mutig als er vorgibt. Im letzten Drittel seines Beitrags, nach seiner Einschätzung der Merkelschen Politik, äußert er gegenüber der Studentin, die bisher eher Stichworte geliefert als tatsächlich widersprochen hat: „Auf dieser Ebene könnten wir endlos weiterreden und von mir aus auch streiten. Aber dazu habe ich keine Lust. Keine politische, keine literarische und keine persönliche.…“ Was antwortet die famose, intelligente Studentin von heute?
„Okay, ich gebe auf.“
Noch aber hat er seine dozierende Tätigkeit nicht aufgegeben. Im Ton eines herablassenden, vermeintlich großzügigen Alten sagt er: „Schade, aber haben sie Dank für ihre Hartnäckigkeit beim Fragen und Nachbohren, so haben wir doch einige Gedanken aufgewirbelt…“ Die Einwürfe der entzückenden Frau E. enden schließlich mit „Ja, ich hab verstanden“, bevor ihr Part endgültig beendet ist und Delius seine Perspektive der europäischen Zukunft in den bereits oben zitierten poetischen Worten schildert.
Im besten Fall kann man diesen Dialog als psychoanalytisches Herantasten begreifen, von vorgeblich ästhetischen Vorbehalten hin zu einem politischen Bekenntnis. Die Art und Weise, wie Delius von Beginn entschieden und dozierend an seine Meinung kundtut, legt diese Lesart aber nicht nahe. Poetologisch liest sich sein Text wie ein Aufruf zum Eskapismus in einer ohnehin verlorenen realen Welt.
Kann Angela Merkel eine Romanfigur werden? Natürlich kann sie es, an dieser Stelle nehme ich mir heraus, Herta Müller zu zitieren: Wörter können und dürfen alles. Ist es nicht einfach große Literatur, mit Worten das Unglaubliche zu schaffen? Dass Delius Merkel nicht als Figur möchte, ist eine Sache, aber ergibt sich daraus wirklich, dass sie keine sein kann?
Im Grunde will sich Delius politisch einmischen, er hat eine Meinung, er möchte sich politisch äußern, aber er meint, dass ihm das in Form eines Romans nicht gelingen kann – alles verständlich. Aber einen Widerspruch in dieser Weise als langweilig abzutun, ist wenig ansprechend. Kann Friedrich Christian Delius eine Romanfigur werden? Jedenfalls nicht meine.
Friedrich Christian Delius: Kann Angela Merkel eine Romanfigur werden? (Sinn und Form Mai/ Juni 2017)