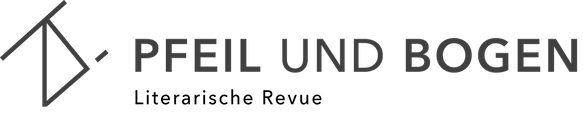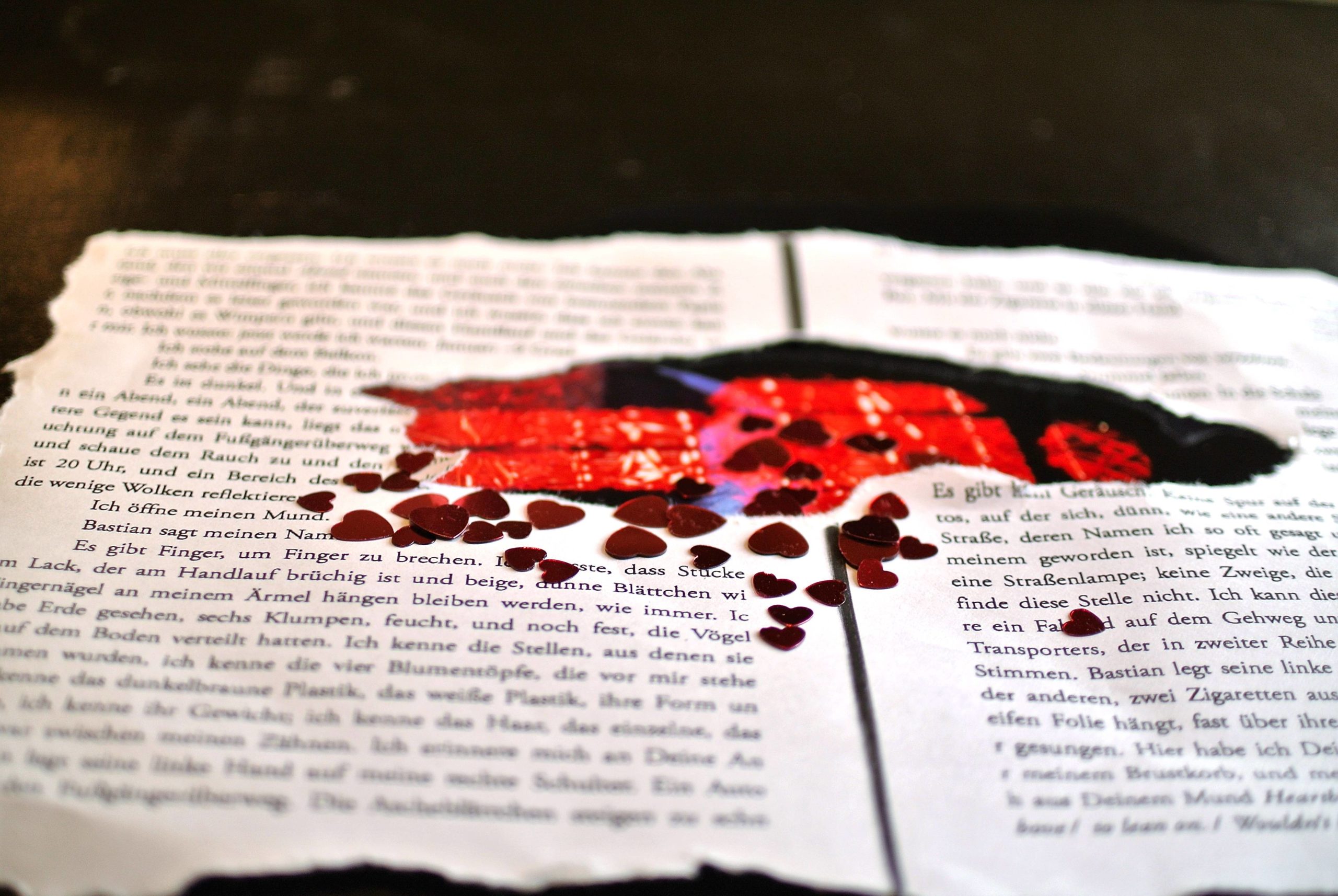Jeder rational Handelnde könnte akzeptieren, dass sich die rein egoistische Tätigkeit anderer rational Handelnder rational rechtfertigen lässt. Wenn zwei rational handelnde egoistische Personen in einer Situation entsprechend ihrer Interessen etwas unterschiedliches wollen, ist diese Diskrepanz vereinbar mit allen rational Handelnden, die den reinen Egoismus akzeptieren. Wenn man Person 1 vertraulich fragen würde, was Person 2 ihrer Ansicht nach vernünftigerweise tun sollte, dann müsste sie vernünftigerweise antworten, sie sollte das tun, was in ihrem Interesse liegt. Diese unterschiedlichen Meinungen widerlegen nicht die Rationalität des reinen Egoismus, sie zeigten aber, dass er kein universalisierbares Prinzip ist.
Demnach müssen rationale Urteile universal gültig sein, es müssen aber nicht unbedingt ethische Urteile sein.1Vgl. Singer, 2018, S. 489 ff. Derek Parfit versuchte Hume durch den Einwand zu widerlegen, es sei vernünftig die eigenen zukünftigen Wünsche miteinzubeziehen, auch wenn man sie jetzt noch nicht wünsche, andernfalls würde es einem nicht gelingen sich als Person zu betrachten, die in der Zeit existiere, in der die Gegenwart lediglich ein Zeitabschnitt unter anderen sei.
Thomas Nagel griff diesen Gedanken auf und argumentierte, so wie man die Gegenwart lediglich als einen Zeitabschnitt unter anderen betrachte, solle man sich selbst lediglich als eine Person unter anderen betrachten und dem folgend die Wünsche anderer berücksichtigen, fand seine Argumentation später aber selbst nicht mehr schlüssig. Sidgwick räumte ein, die Unterscheidung zwischen Individuen könne nicht aufgehoben werden, da jeder sich mit seinem eigenen Denken intensiver befasse als mit dem eines anderen. Intuitiv wirkt es richtig eine Schramme am eigenen Finger dem Ruin eines Dutzends anderer Menschen vorzuziehen, mithilfe der Vernunft lässt sich jedoch nicht beweisen, dass es richtig ist das zu tun, was unparteiisch gut ist.
Ich möchte das Scheitern am Prinzip der gleichen Interessenabwägung, was zu negativen Konsequenzen für eine Vielzahl von Personen führt, nun aus einer spirituellen Perspektive beleuchten, die nicht wertend ist und die Welt als Kreislauf betrachtet. Angenommen unser Handeln und der daraus resultierende Zustand der Welt spiegelt unser Inneres wieder, gibt es zwei grundlegende mögliche Entwicklungen. Im ersten Fall würde sich die Menschheit positiv entwickeln, also in Richtung eines erleuchteten Zustands, der von Empathie geprägt ist, die Trennung zwischen einzelnen Individuen aufhebt und somit Sidgwicks Standpunkt des Universums einnehmen und eine Evolution vollziehen. Es könnte sein, dass wir uns auf diesem Weg befinden. Geschichte scheint sich zu wiederholen, Kriege, Korruption und Umweltverschmutzung sind allgegenwärtig, jedoch findet ein gewisser Bewusstseinswandel statt.
Während in antiken Agrargesellschaften 15 % der Menschen durch Gewalt starben, sind es heute nur noch 1 %, die durch Krieg und Kriminalität2Vgl. Yuval Noah Harari: Homo Deus. Eine Geschichte von Morgen, München: C. H. Beck, 2018, S. 29 umkommen. Im zweiten Fall würde die Menschheit es nicht schaffen sich zu zu wandeln und weiterhin Raubbau an der Natur betreiben. Es könnte passieren, dass die Erde in einigen Jahrzehnten unbewohnbar wird und die Menschheit ausstirbt. Eine dritte Option, die für dieses Gedankenspiel eine geringere Bedeutung hat, wäre eine Deus ex machina-Lösung, die es Menschen wegen technischer Entwicklungen erlauben würde ihren bisherigen Lebensstil unbeschadet fortzuführen. In der Vergangenheit sind schon andere Tierarten ausgestorben und für das Universum spielt es keine Rolle, ob es von Menschen bewohnt wird.
Fraglich ist, ob die Menschheit zum kollektiven Aussterben bereit ist oder nicht. Jeder von uns weiß um die Gefahr, mithilfe von Rationalisierung und Verdrängung wissen wir sie ebenso effizient zu verbannen. Geschieht die Verbannung aufgrund der Unerträglichkeit der Angst, wegen eines unbewussten Todeswunsches oder wegen der schlichten Weigerung Änderungen vorzunehmen? Es wird eine Mischung aus allem sein, eine Mischung deren Konsequenzen wir in Kauf nehmen müssen. Ich möchte anderen keine Entscheidungs- und Verhaltensvorschriften machen, ich verbitte mir lediglich die Blindheit gegenüber dem Offensichtlichen.
Es ist nicht unmöglich, aber schwierig Gewohnheiten aufzugeben. Menschen sind immer dann für die Erhöhung des Höchststeuersatzes, wenn dieser sich oberhalb ihres eigenen Einkommens befindet. Ich echauffierte mich über griechische Oligarchen, die ein Billionenvermögen besitzen, trotzdem kaum Steuern zahlen und auf äußerst umweltschädliche Weise ihr Vermögen vermehren. Ich kann den Wunsch nach Luxus verstehen. Aber wie viel mehr braucht ein Mensch, wenn er nicht mal bis zu seinem Lebensende alles ausgeben kann und selbst seine Enkelkinder davon leben können? Das Problem ist die Gewohnheit. Ich möchte nicht auf meine jährliche Flugreise verzichten, jemand anderes nicht auf die vierte Yacht.
Fragwürdig ist, dass die Konsequenzen dieser Handlungen vor allem andere gravierend treffen als die handelnden Personen. Die in Kaufnahme dessen bedeutet das evolutionäre Recht des Stärkeren hinzunehmen, allerdings folgt aus dieser “Evolution“ auf lange Sicht der kollektive Tod. Einige Wissenschaftler*innen versuchten zu zeigen, dass altruistisches Handeln ein evolutionärer Vorteil ist, der sich positiv auf die Gruppenselektion auswirkt. Diese These stellt ein Problem für die Evolutionstheorie dar und wird immer noch diskutiert. Zwar existiert reziproker Altruismus in der Natur, dieser bringt aber Vorteile für beide Beteiligte und ist somit nicht selbstlos.
Würde man das utilitaristische Prinzip der gleichen Interessenabwägung konsequent umsetzen, wäre eine radikale Umstrukturierung der Welt vonnöten. Ressourcen müssten geschont und gleich verteilt werden, kollektive sowie individuelle Privilegien aufgegeben werden. Mehr noch, jede Entscheidung müsste hinsichtlich ihrer Nützlichkeit überprüft werden. Es ist eindeutig nützlicher 50 Euro zu spenden anstatt sie für ein neues Kleidungsstück, einen Restaurant- oder Friseurbesuch auszugeben, wobei die Betreiber*innen all dieser Einrichtungen ebenfalls Ressourcen benötigen.
Die Nahrungsmittel und Substanzen, die konsumiert werden, müssten hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Gesundheit gewählt werden, denn Krankheit mindert die Produktionsfähigkeit und belastet die Gesundheitssysteme. Laster jeglicher Art müssten eingeschränkt werden, dabei sind sogenannte Laster weitaus freudvoller und kreativitätsfördernder als alles Nützliche. Es macht weitaus glücklicher Geld für eine unnütze Taxifahrt auszugeben, um mitten in der Nacht die Liebe zu besuchen als den selben Betrag für Waschpulver auszugeben.
Als Mill das Nützlichkeitsprinzip formulierte, enthielt dieses ein gesellschaftskritisches, demokratisierendes Element, denn es forderte Handlungen nicht durch Moralvorstellungen zu bewerten, sondern lediglich hinsichtlich der Auswirkungen der Handlungsfolgen auf das Glück der betroffenen Personen. Demnach habe man zwar das Recht das Verhalten anderer nicht zu mögen und deswegen den Umgang mit ihnen zu meiden, aber solange sie anderen keinen Schaden3Vgl. John Stuart Mill: Über die Freiheit. Ditzingen: Reclam, 1974, biographisch ergänzte Ausgabe 1988, S. 109 zufügen, dürfe man sie nicht moralisch verurteilen. Dieses Vorgehen erlaubt Freiheit bei privaten Entscheidungen wie der Wahl des Beziehungsmodells oder der Kleidung.
Einerseits existieren in der heutigen Zeit für solche Entscheidungen mehr Freiheiten als zu Mills Lebzeiten, andererseits ist durch ökonomische Verflechtungen und ökologisches Bewusstsein ersichtlicher, dass nur die wenigsten Entscheidungen ausschließlich private Auswirkungen haben. Das Leben ist letztendlich die Möglichkeit eine Fülle von Entscheidungen zu treffen und ihre Konsequenzen zu erfahren. Diese Möglichkeit sollte und kann nicht eingeschränkt werden, denn das würde bedeuten auf ein festgelegtes Ende diktatorisch hinzuarbeiten. Die Frage ist in was für einer Welt jede einzelne Person leben möchte und welche Erfahrungen sie dort machen möchte. In der Summe der Entscheidungen und Lebensentwürfe wird sich zeigen welche Entwicklung sich in Zukunft vollziehen wird.